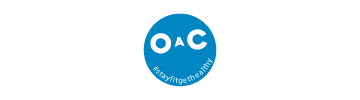Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Wie funktioniert die Prostata-Entfernung mit dem Roboter?
10. Oktober 2025 | von Redaktion Prostata Hilfe DeutschlandBei Prostatakrebs wird die Prostata oft im Rahmen einer Operation entfernt. Wie die radikale Prostatektomie mit Hilfe eines Roboter funktioniert und welche Vorteile dies hat, erklärt der Tumorchirurg Prof. Philipp Nuhn.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden.
Wenn Sie dieses Modul sehen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an.
Prof. Dr. Philipp Nuhn: Die Prostata lässt sich mit Hilfe eines Roboters entfernen. Das funktioniert speziell bei Prostatakrebs, aber man kann auch eine gutartige Prostatavergrößerung damit therapieren. Noch mal kurz: Die Prostata liegt tief im Becken, also relativ ungünstig. Ungünstig ist es auch, das unter der Prostata der Schließmuskel der Harnblase liegt, mit dem Sie den Harnstrahl willkürlich unterbrechen können. Das heißt: Wenn Sie Wasser lassen oder den Harnstrahl stoppen wollen, dann müssen Sie diesen Schließmuskel betätigen. Wir haben weiter oben noch einen zweiten Schließmuskel, den Sie aber nicht so ansteuern können. Ein weiteres Problem ist, dass die Harnröhre durch die Prostata hindurchgeht.
Für die Sexualfunktion laufen die Nervenfasern auf der Prostata entlang. Sie sind dafür verantwortlich, dass es zu einer Erektion kommt, zu einer Versteifung der Schwellkörper. Diese Nervenfasern liegen dicht an der Prostata. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem hartgekochten Ei, ähnlich wie die Eipelle. Es besteht eine sehr feine Verbindung. Deshalb ist es nicht so einfach, eine Prostata komplett herauszuoperieren, weil die Strukturen in der Umgebung sehr nahe liegen. Hinter der Prostata befindet sich der Enddarm. Über diesen können wir die Prostata gut abtasten. Die Prostata liegt also sehr tief im Becken, es gibt nur kleine räumliche Bereiche und enge Lagebeziehungen.
Prostata-OP mit Roboter Warum Ärzte für jeden Millimeter bei der OP verantwortlich sind, erklärt der Tumorchirurg Prof. Philipp Nuhn. |  |
|---|
Biopsie mittels MRT-Kontrolle
Wenn wir jetzt ein Prostatakarzinom therapieren, ist es in der Regel so: Sie waren beim Urologen oder beim Hausarzt und haben eine PSA-Kontrolle bekommen. Dort ist etwas Auffälliges gefunden worden und in der Regel schicken wir die Patienten heute ins MRT. Kleine Veränderungen sieht man meist in der peripheren Zone. Da entstehen die meisten Prostatakarzinome. Danach müssen wir Proben nehmen. Das heißt, wir stechen mit einer feinen Biopsie-Nadel in die Prostata hinein. Früher hat man das Finger-geführt gemacht, mittlerweile nutzen wir zur Steuerung der Biopsie die Ultraschall-Unterstützung. Was wir jetzt vielfach machen, da haben wir wahnsinnig profitiert von dem radiologischen Fortschritt: Wir nehmen das MRT-Bild und seine ganze Information. Daraus bauen wir im Grunde ein 3D-Modell. Wir machen Ultraschalluntersuchungen am Patienten, überlagern das und haben die Möglichkeit, dass wir in den auffälligen Arealen gezielt Biopsien entnehmen können.
Das Ganze funktioniert mit Unterstützung von Geräten. Früher waren diese Geräte deutlich größer, aber mittlerweile passen die Software und die ganze Technik in ein kleines Gerät hinein. Wir haben gestern bei uns im Uni-Klinikum in Kiel zum ersten Mal ein neues Gerät genutzt. Wir machen die Untersuchung nicht über den Enddarm. Das ist eine Möglichkeit, die wahrscheinlich noch am häufigsten durchgeführt wird. Stattdessen machen wird die Biopsie über den Damm. Das heißt, dass der ganze Eingriff sicherer ist. Die Gefahr ist geringer, dass Bakterien in die Prostata hineinkommen.
Jetzt haben wir also eine Erhöhung des PSA-Wertes, einen auffälligen Befund, haben das MRT bekommen, haben eine Biopsie erhalten und jetzt ist die Frage: Müssen wir überhaupt therapieren? Wir versuchen, diese invasiven Therapien - nicht nur die Operation, sondern auch die Strahlentherapie - möglichst weit hinauszuzögern. Wir möchten nur die Patienten operieren oder bestrahlen, die davon profitieren und wo es unausweichlich ist, dass wir therapieren. Hier sind bestimmte Kriterien zu erfüllen. Das ist individuell manchmal ein bisschen anders, aber die Leitlinie gibt Dinge vor. Der PSA-Wert sollte in einem gewissen Bereich liegen und das Aggressivitätsmuster in der Biopsie sollte bestimmte Bedingungen erfüllen.
Operation: Prostata und mehr entfernen
Bei der gutartigen Prostatavergrößerung haben wir nur das Ziel , den abgedrückten Anteil der Harnröhre wieder freizumachen. Dagegen geht es bei Prostatakarzinomen darum, das ganze Organ herauszubekommen - samt der anhängenden Samenblase. Das müssen wir so machen, damit wir eine onkologische Sicherheit haben, Das heißt: Alle Krebszellen sollen aus dem Körper entfernt werden. Gleichzeitig wollen wir die umliegenden Strukturen schonen. Wir wollen den Schließmuskel nicht beschädigen, damit die Patienten danach gut Wasser lassen und umgekehrt das Wasser halten können. Wir brauchen eine gute Verbindung haben zwischen dem Harnröhrenstumpf und dem Harnblasenhals. Außerdem wollen am Enddarm, dem Rektum, keine Verletzung erzeugen.
Wenn der Tumor nicht so nah an die Nervenbahnen herankommt, wollen wir auch versuchen, jene Nervenstrukturen zu erhalten, die über die Prostatakapsel hinwegziehen. Nach der Operation soll nicht nur Tumorfreiheit bestehen, sondern auch eine gute Kontinenz und Erektionsfähigkeit. Am Ende soll das so aussehen: Alle Strukturen sollen möglichst intakt bleiben, wir haben eine Verbindung geschaffen zwischen der Blase und dem Harnröhrenstumpf - und die Prostata ist draußen.
Operation mit Roboter
Früher haben wir bei der Prostataenfernung offen operiert. Das heißt, wir haben zwischen Bauchnabel und Schambein einen Schnitt gemacht und dann den Unterbauch eröffnet. Mit Hilfe des Roboters können wir das Ganze heute minimal-invasiv durchführen. Prinzipiell wäre es auch möglich, konventionell laparoskopisch über die Schlüssellochtechnik im Rahmen einer Bauchspiegelung zu operieren. Die Vorteile des Roboters werde ich Ihnen in den nächsten Minuten erläutern.
Das hier ist ein Blick in einen Patienten, bei dem wir den Unterbauch eröffnet haben. Sie sehen hier vorne den Beckenknochen und hier unten geht es in die Harnröhre. Wir haben hier die Prostata, die Blase oben dran und hier ist die Prostata jetzt gut schon präpariert. Wir sehen, hier vorne kommt der Katheter raus. Er geht in Richtung Penisspitze. Hier ist der Harnröhrenstumpf und letztendlich geht es darum, dieses Organ hier mitsamt der Samenblase zu entfernen.
Dieser Roboter, den wir jetzt am Universtitätsklinkum Schleswig Holstein nutzen, ist mittlerweile das dritte System der neuesten Generation. Der letzte kam in Dezember vergangenen Jahres und ist eine Entwicklung, die aus dem Militär kommt. Man hat sich überlegt, dass man für den Fall, dass kein besonders erfahrener Operateur für eine Operation verfügbar ist, mit Hilfe einer Datenübertragung Operationen anbieten kann. Das hat sich aber so nicht bestätigen lassen. Wir haben aber gerade in der Urologie sehr von diesen Systemen profitiert.
Letztendlich ist es kein wirklicher Roboter. Ein Roboter wäre ein Apparat, der - wie in der Autoindustrie - programmiert wird, und dann eine bestimmte Arbeit selbstständig ausführt. Letztendlich ist es eine Art Telemanipulator, der über Seilzüge arbeitet und im Prinzip die Bewegungen überträgt, die wir als Operateure in der Konsole machen. So sieht das aus. Hier sind diese Handgriffe, die er in diesen Roboterarm überträgt.
Dann gehen wir über kleine Zugänge in den Bauchraum des Patienten. So sieht das im OP aus, natürlich alles steril bezogen. Dann werden hier an diese Arme die entsprechenden Instrumente herangepackt. Das ist der Blickwinkel des Operateurs. Sie sitzen und schauen hier oben in die Okulare. Der Vorteil von diesem Robotersystem ist, dass es mit zwei Kamerasystemen arbeitet. Das heißt, Sie kriegen anders als in der Endoskopie wirklich ein 3D-Bild, weil zwei Bilder zusammengefügt werden. Sie haben hier vorne Handgriffe, mit denen Sie diese Bewegung durchführen können. Das wird teilweise ausgeglichen. Zitterbewegungen, die man natürlicherweise hat, werden abgeflacht. Wir können mit kleinen Bewegungen hier im Millimeterbereich Bewegungen auf die Instrumente übertragen.
Die Instrumente sind fein und klein. Das hier ist ein Nadelhalter, der letztendlich kleiner als in der offenen Chirurgie ist. Ein großer Vorteil, und das ist der Unterschied zur normalen Laparoskopie und Schlüssellochtechnologie, ist, dass sie eine sogenannte EndoWrist-Technologie haben. Das heißt, sie können den Instrumentenkopf über diese Seilzüge in verschiedene Richtungen bewegen. Bei der konventionellen Laparoskopie können sie mit dem Gerät nur vor und zurück und den Winkel ändern.
Hier können sie diese Freiheitsgrade, die Sie haben, wenn Sie offen operieren, nachempfinden, wie das von Natur aus auch mit der Hand funktioniert. Das ist der riesige Vorteil. Wir können jetzt laparoskopisch, minimal-invasiv operieren. Gleichzeitig sind wir nicht eingeschränkt mit den Freiheitsgraden und können im Grunde alles machen, was wir, wenn wir offen operieren, mit den Händen tun könnten. Und wir haben eine viel bessere Sicht. Wir kommen nah ran, haben diese feinen Instrumente und können jetzt Strukturen erkennen, die Sie sonst beim offenen Operieren nur mit der Lupenbrille sehen oder nicht nachvollziehen können. Das bringt Vorteile.
Der andere Vorteil bei diesem Roboter-Verfahren ist, dass wir, wie bei der normalen Laparoskopie, mit Druck im Bauch arbeiten. Da wird CO2 in den Patienten eingebracht. Dieser Druck führt dazu, dass kleine Blutgefäße nicht so bluten wie bei der offenen Operation. Sie haben eine bessere Sicht durch die Vergrößerung, aber auch eine bessere Sicht, einfach weil es trockner und übersichtlicher bleibt. Um Ihnen mal zu zeigen, wie diese Instrumente arbeiten können: Hier ein Fall, wo man versucht, die Schale der Traube abzuziehen. Das illustriert schön, was wir für Freiheitsgrade mit den Instrumenten haben. Alles das, was wir offen operativ machen können, lässt sich jetzt über diese Handbewegung in den Patienten hineinmanövrieren.
So sieht das Ganze im OP aus. Wir haben den Kollegen der Anästhesie, der den Patienten in Narkose versetzt, in eine Vollnarkose. Dann werden Zugänge etabliert, damit wir diesen Roboter andocken können und Instrumente werden eingeführt. Wenn die Instrumente richtig positioniert sind, setzt sich der Chirurg an die Konsole und kann diese Bewegungen ausführen. Es steht immer ein Assistent daneben, der Instrumente wechseln kann, beim Saugen und so weiter assistiert und für den Fall, dass irgendwie mal was nicht funktioniert oder klemmt, Der Operateur Nummer zwei steht nur drei Meter neben dem Patienten und bekommt alles mit.
Es ist nicht so, dass wir im Nachbarraum sitzen oder weiter weg, sondern Sie sehen, dass hier alle vor Ort im OP-Saal sind. Wir haben kleine Zugangswege und können auf den großen Schnitt verzichten. Das Wichtigere bei der radikalen Prostatektomie, also der Entfernung bei Prostatakrebs, ist letztlich, dass wir eine gute Sicht haben und in diesem tiefen Bereich unten einfach mit diesen Instrumenten besser zurechtkommen.
Was passiert jetzt genau? Ich hatte das eben beim offenen Bild schon dargelegt. Wir haben hier die Prostata. Wichtig ist, dass der Harnblasenhals möglichst erhalten wird bei der Operation. Wir wollen nur so viel wie nötig entfernen. Dann ist es wichtig, dass wir vorne den Harnröhrenstumpf schön präparieren, damit die Kontinenz nach der Operation gut ist. So sieht das aus, wenn die Prostata entfernt worden ist. Wir haben diesen Harnröhrenstumpf. Wir haben den Harnblasenhals und das Ganze wird verbunden. Die Idee ist, dass Sie nach einigen Tagen wieder normal Wasser lassen können, ohne dass Urin nach außen tritt. Bevor das Wasserlassen freigegeben ist, kommt in der OP noch ein Katheter in die Harnröhre. Er verbleibt ungefähr vier bis fünf Tage dort. In der Zeit ist in der Regel die Heilung so weit fortgeschritten, dass wir ihn herausziehen können.
Die Vorteile vom Roboter sind, dass wir kleine Strukturen erkennen können und in den Bereichen, wo wir sonst beim offenen Operieren eher schlecht hinkommen, wirklich feine Bewegungen ausführen können. Sie sehen, dass ist hier eine Technik, die man beim offenen Operieren, letztendlich gar nicht in der Form durchführen kann. Wir können versuchen, die Harnröhre im Beckenboden entsprechend zu stabilisieren. Wir können Verbindungen schaffen zur Blase, dass das entsprechend angehoben wird und der Schließmuskel am Ende der Operation besser arbeiten kann. Da ist dieses Verfahren ein Riesenvorteil. Sie können auf einer Fläche - auf einem Volumen eines kleinen Joghurtbechers - diese ganzen Untersuchungen und Bewegungen machen. Das können Sie beim offenen Operieren in der Form nicht tun, weil die Prostata einfach so tief unten im Becken liegt.
Nach der Prostata-OP
Die wichtige Aufgabe bei der Operation ist, diesen Schließmuskel zu erhalten und die Grundlage dafür zu legen, dass wir die bestmögliche Kontinenz nach der Operation haben. Wichtig ist auch, dass Sie, wenn Sie operiert worden sind und alles einigermaßen abgeheilt ist, nach ein bis zwei Wochen mit den Beckenbodenübungen anfangen. Da ist es wichtig, dass Sie sich von Ihrem Urologen jemanden an die Hand geben lassen, der das wirklich gut beherrscht.
Beckenbodentraining ist nicht so trivial. Der Physiotherapeut kann Ihnen das nur erklären und da gibt es deutliche Unterschiede. Wichtig ist, dass das konsequent und gut geübt wird. Die andere Sache, das hatte ich auch vorgestellt, ist, dass die Erektionsfähigkeit davon abhängt, dass die Nerven erhalten werden. Wir haben die Möglichkeit, mit dieser hohen Vergrößerung, mit einer recht bluttrockenen Situation, ganz fein diese Schichten entsprechend von der Prostatakapsel abzutragen. Und die Möglichkeit, dass der Patient danach, ohne dass er medikamentöse Unterstützung bekommt, eine Erektion bekommt, ist entsprechend höher, als wir das vom anderen Verfahren her kennen.
Wenn wir operiert haben - die Operation dauert ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden - versuchen wir, wenn möglich, die Pathologie mit ins Spiel zu bekommen. Das heißt, wir entfernen die Prostata und schicken sie während der Operation zu den Pathologen. Die schauen, ob die Schnitt- oder Resektionsränder alle tumorfrei sind. Dann werden wir am Ende der Operation einen Katheter einsetzen. Und Sie sind relativ schnell wieder fit. So nach zwei bis drei Tagen laufen die Patienten auch mehr oder weniger ohne Einschränkung über die Station. Sie haben dann noch den Katheter. Und wir machen am fünften Tag ein Röntgenbild. Da wird die Blase mit Kontrastmittel gefüllt und wenn alles dicht ist, kommt der Katheter aus. Er wird entfernt und die Patienten können anfangen, normal Wasser zu lassen. Am Anfang ist das sicherlich noch schwierig, weil sie jetzt lernen müssen, mit dem Beckenboden entsprechend zu arbeiten, aber in der Regel klappt das recht gut.
NutzerfragenModerator: Sehr eindrucksvoll, Herr Professor Nuhn. Ein, zwei Fragen sind natürlich noch da. Die erste Frage, die eingeschickt wurde: Wann ist der Zeitpunkt bei nachgewiesenem Prostatakarzinom, die aktive Überwachung zu beenden und sich für einen Eingriff zu entscheiden? Prof. Dr. Philipp Nuhn: Das lässt sich so allgemein nicht gut beantworten, weil viele Faktoren hereinspielen. Letztendlich, aktive Überwachung ist von uns, von der Strahlentherapie, von der Urologie, die operiert, das Ziel, dass wir die Therapie hinausschieben, dass sie über dieses Aufschieben dieses Eingriffs oder der Strahlentherapie die möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen, die entstehen könnten, zu diesem Zeitpunkt, wo es nicht dringend nötig ist, nicht erleben. Es bleibt aber immer in einem Konzept so erhalten, dass wir zu jedem Zeitpunkt einsteigen können mit der Therapie und sie durch diese Wartezeit keinen Nachteil haben. In der Regel hängt das vom PSA-Wert ab. Wenn der mit der Zeit deutlich steigt oder wenn sie im MRT, was noch mal gemacht worden ist, eine größere Zunahme des Tumors haben, würde man agieren. Wenn man gegebenenfalls noch mal eine Biopsie macht und feststellt, dass das Wachstumsmuster aggressiver ist, würde man handeln. Aber das ist eine Sache, die muss man individuell besprechen, weil viele andere Dinge reinfallen, wie Lebensalter, Komorbiditäten des Patienten, Wunsch des Patienten. Man hat auch manchmal die Möglichkeit, individuell das Risiko anders einzuschätzen. Das muss man gut besprechen mit dem niedergelassenen Urologen, vielleicht auch mit dem Kollegen in der Klinik, der sie operieren kann, oder dem Strahlentherapeuten. Moderator: Da muss man sich gut beraten lassen. Eine zweite Frage schaffen wir noch, die auch gestellt worden ist. Ich zitiere: „Viele Kliniken sind als Prostatakrebszentren zertifiziert. Was bedeutet das? Und sollte ich bei der Auswahl der Klinik eben darauf achten?“ Prof. Dr. Philipp Nuhn: Zertifizierung heißt, dass die Deutsche Krebsgesellschaft Besuche abstattet in der Klinik und schaut, ob wir leitliniengerechte Therapie durchführen. Das ist eher auf Prozesse abgestellt. Das heißt, arbeiten wir interdisziplinär zusammen, werden die Patienten in Tumorkonferenzen vorgestellt, haben wir genügend Ausstattung, haben wir genügend Fallzahlen. Es ist sicherlich ein Qualitätsmerkmal. Wenn Sie sich an einem Zentrum operieren oder bestrahlen lassen, sollte dieses Zentrum ein entsprechendes Zertifizierungszeugnis auch vorlegen können. Aber es ist nicht so, dass die Zertifizierung Ihnen sagt, dass an diesem Klinikum Strahlentherapie oder eine Operation, besonders häufig durchgeführt wird. Es ist keine Ergebnisqualität. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass das Zentrum, an dem Sie sich vorstellen und therapiert werden wollen, dass das zertifiziert ist. Aber Sie müssen auch auf andere Dinge Acht geben, beispielsweise, ob es an dem jeweiligen Standort darüber hinaus eine sehr große Erfahrung gibt. |