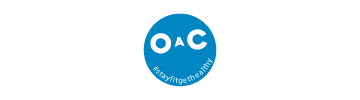Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Ist Bewegung ein wichtiger Teil der Krebstherapie?
10. Oktober 2025 | von Redaktion Prostata Hilfe DeutschlandWie lässt sich der Verlauf einer Krebserkrankung durch Bewegung beeinflussen? Wie kann ich den inneren Schweinehund überwinden? Und welche Angebote bekommen Menschen mit Krebs von Ärztinnen und Ärzten? Diese Fragen beantwortet die Psychologin PD Dr. Laura Schmidt.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden.
Wenn Sie dieses Modul sehen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an.
PD Dr. Laura Schmidt: Wie hängen körperliche Aktivität und Krebserkrankungen zusammen? Das ist mein Thema heute. Was ich nicht vertiefen werde, ist der Bereich, den man Primärprävention nennt. Das heißt, wie kann der Lebensstil oder eine Verhaltensänderung eine Krebserkrankung verhindern? In der Primärpävention wird auch sehr viel geforscht. Man geht davon aus, dass etwa 40 Prozent der alljährlich in Deutschland diagnostizierten Krebsneuerkrankungen vermeidbar wären. Das sind aber nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es kausal ist. Das bedeutet nicht. dass jemand, der sich ausreichend bewegt, keinen Krebs bekommen wird. Das ist wichtig, das zu erklären.
Was ich heute besprechen möchte, ist das Thema: Wie können wir den Verlauf von bestehenden Krebserkrankungen positiv beeinflussen? Wie sieht es aus? Wie ist der Ist-Zustand? Was wird empfohlen? Wie werden Bewegungsberatungen in Deutschland umgesetzt? Empfehlen Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Pflegepersonal ihren Patientinnen und Patienten überhaupt Bewegung?
Ein kleines Thema ist noch der innere Schweinehund. Ich arbeite mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen und im englischen Sprachraum gibt es den inneren Schweinehund nicht. Wir kennen dieses Tier. Das heißt nicht, dass die Personen im anderen Sprachraum diese Motivationsprobleme nicht haben, aber der innere Schweinehund ist anscheinend eine deutsche Erfindung.
Interview Bewegung ist in allen Phasen der Krebserkrankung wichtig, betont die Psychologin Dr. Laura Schmidt. |  |
|---|
Körperliche Aktivität statt Schonung
Zur Ausgangslage: Es gab einen gewissen Paradigmenwechsel in den letzten 10 bis 20 Jahren. Von der Aussage „Schonen Sie sich, Sie brauchen Ihre ganze Energie für die Krebstherapie“, bis zum heutigen Stand „Seien Sie körperlich aktiv, der Körper muss fit sein, um die Therapie gut zu überstehen“. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich nicht auf jeder Folie das Wort „Prostata" stehen habe. Das liegt daran, dass wir uns auch in der Forschung an der Uni Heidelberg eben häufig mit verschiedenen Krebsarten beschäftigen. Das heißt, das gilt sowohl für Brustkrebs und Darmkrebs als auch für Prostatakrebs. Hier sind auch viele Frauen anwesend. Es ist ein bisschen übergreifender, wobei auch ein paar Prostatastudien dabei sein werden.
Gibt es wissenschaftliche Beweise?
Es gibt sehr viele Studien mit einer hohen Evidenz. Das bedeutet, dass die Wirksamkeit körperlicher Aktivität bei Krebs gut belegt ist. Zum Beispiel können Lymphödeme vermieden oder verbessert werden können. Bei der Kraft und Ausdauerleistungsfähigkeit, aber auch im psychologischen Bereich wie bei Angst oder depressiven Verstimmungen haben wir sehr große Effekte durch körperliches Training.
Es gibt auch schon abgeleitete Kriterien, wie man trainieren soll. Dies hängt aber vom Trainingsziel ab. Wenn ich beispielsweise unter einer Fatigue leide, einem Erschöpfungssyndrom, gibt es ausgearbeitete FITT-Kriterien. Die Abkürzung steht für “Frequency, Intensity, Time und Type”. So weiß ich genau, auf welche Art ich trainieren muss. Mit welcher Intensität? Wie lange? Wie sind die Umfänge? Und ich weiß genau, welche Sportarten oder welche Bereiche ich trainieren muss.
Man hat inzwischen sehr spezifische Leitlinien, die auch in einer guten Bewegungsberatung empfohlen werden sollten. Die Bewegung ist wie Medizin. Es gibt es diesen Spruch „Exercise is Medicine." Nur können wir die eben nicht einnehmen am Morgen und am Abend, sondern wir müssen uns selbst darum kümmern, das umzusetzen. Was sehr spannend ist, in vielen Studien wurde geschaut: Macht es einen Unterschied, ob ich mich bei einem strukturierten Bewegungsprogramm anmelde und da teilnehme, oder ob ich den Sport eigenverantwortlich mache, also zu Hause durchführe.
Zu sehen waren positivere Effekte für strukturierte und supervisierte Programme. Wenn ich mein Leben lang sportlich aktiv war und mich auskenne in der Sportart, kann ich das auch eigenverantwortlich gut umsetzen und werde wahrscheinlich kein Motivationsproblem haben. Aber für alle anderen, vielleicht auch für Menschen, die vorher nicht so aktiv waren, macht es durchaus Sinn, sich in ein strukturiertes Programm zu begeben.
Ich hatte gesagt, ein bisschen was zur Prostata habe ich auch dabei. Es gibt inzwischen sehr gute Meta-Analysen, die mehrere Studien ausgewertet haben. Sie haben sich auch mit der Mortalität, also den ganz harten Fakten des Überlebens, beschäftigen. Das sind Studien, die sich angesehen haben: Wie ist die Überlebenswahrscheinlichkeit von Menschen, die die Diagnose Prostatakrebs, Darmkrebs oder Brustkrebs bekommen haben und körperlich aktiv sind. Verglichen wurden sie mit jenen, die nicht körperlich aktiv sind. Es gibt immer ein relatives Risiko, das man sich ansehen kann. Man kann das auch in Prozent ausdrücken. Es gab eine Verringerung der krebsspezifischen Mortalität von 30 bis 33 Prozent durch körperliche Aktivität. Bei der Gesamtsterblichkeit war die Reduktion sogar noch größer.
Das liegt daran, dass das nicht isoliert zu betrachten ist. Wenn ich mich intensiv bewege, wirkt das zum Beispiel auch auf meine Herzgesundheit und die Gesamtmortalität sinkt sogar noch stärker. Bei den Mechanismen, warum das so ist, wird vieles diskutiert. Es könnten antientzündliche Prozesse angestoßen werden. Diskutiert wird auch, dass die Muskeln bestimmte Eiweiße ausschütten, sogenannte Myokine, die auch die Tumorzellen bekämpfen können. Es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen. Aber wichtig ist zu wissen, dass körperlliche Aktivität wirkt.
Welche Bewegung und wie viel?
Die Frage ist: Wie kann man Menschen unterstützen, die aktiv werden wollen, das aber bisher nicht umsetzen konnten? Wie muss ich denn jetzt trainieren? Wie viel muss ich trainieren? Da merkt man oft, dass diese Empfehlungen gar nicht so sehr bekannt sind. Das hat viele Gründe, vielleicht auch strukturelle, dass die Empfehlungen noch nicht so im Praxisalltag gegeben werden.
Die generelle Empfehlung ist, dass man dreimal pro Woche für mindestens 30 Minuten ein Ausdauertraining machen sollte. Manche haben vielleicht auch schon diesen 150 Minuten gehört von der Weltgesundheitsorganisation der WHO und das soll auch in moderater Intensität mindestens sein. Das heißt, ich muss schon etwas außer Atem kommen, ins Schwitzen kommen. Das ist eben nicht der Spaziergang.
Zusätzlich sollte ich Krafttraining machen - zwei Einheiten pro Woche mit 60 Prozent der Maximalkraft. Dazu täglich Dehnübungen. Wirklich jede Bewegung ist besser als keine. Ich finde es manchmal schwierig, sehr hohe Empfehlungen zu geben an Menschen, die vielleicht ganz inaktiv sind. Das ist nicht motivierend. Da ist es auch sinnvoll, kleine Ziele zu setzen, die in den Alltag passen und umsetzbar sind. Man kann sich ja steigern.
Das ist das Schöne am Sport und an der Bewegung. Man sieht die kleinen Erfolge, kann Erfolgserlebnisse aufbauen, seine Selbstwirksamkeit, so nennen wir das in der Psychologie, steigern und die Aktivität steigern. Die Maßgabe ist: „Ärzt*innen sollten die Patient*innen entsprechend beraten." Und genau das war eine Frage, die wir uns in einem Projekt in Heidelberg auch gestellt haben. Da komme ich gleich dazu: Wie sieht das wirklich aus? Wie häufig geschieht eine Beratung?
Vielleicht haben Sie ihre letzten Arzttermine im Kopf. Hat Ihnen da jemand empfohlen, dass sie körperlich aktiver sein sollten? Hat jemand nachgefragt, wie aktiv sie sind? Hat jemand vielleicht sogar assistiert und gesagt: „Hier gibt es ein Programm. Hier ist der Flyer.“ Das hat uns sehr interessiert und da komme ich noch darauf zu sprechen. Aber ein Wort möchte ich Ihnen auch noch nahelegen.
Sport vor der Prostata-OP
Vielleicht kennen Sie es auch schon: „Prähabilitation." Das hat man bei Herrn Lonneman sehr schön gehört. Er sagte, zwei Tage vor der OP war der letzte Trainingslauf. Das ist nachweisbar mit einer guten Evidenz belegt: Wenn Sie mit einem besseren Trainingszustand in eine OP gehen, dann sind Sie auf einem höheren Funktionsniveau. Die OP wird dann Sie zurückwerfen, aber es geht schneller wieder nach oben. Das heißt, wenn man weiß, es kommt ein geplanter Eingriff, kann man sich sozusagen aufzutrainieren und sich besser darauf vorzubereiten. Das macht Sinn, weil man schneller wieder auf die Beine kommt. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist in verschiedenen Bereichen belegt, sowohl unter der OP als auch nach der OP, so dass auch eine Wiederaufnahme seltener sein muss. Die Prähabilitation lohnt sich.
Fatigue
Auf Fatigue wollte ich noch kurz zu sprechen kommen. Das ist eben eine mangelnde Energie. Auch Antriebslosigkeit, Interessenlosigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten gehen damit einher. In der Corona-Pandemie ist uns dieses Wort häufig begegnet. Wichtig ist bei einer Fatigue: Führt es nicht oder nur ganz minimal zu einer Erholung, wenn ich mich ausruhe oder schlafe ? Das ist anders als bei einer Erschöpfung, die vielleicht durch eine Überanstrengung gekommen ist. Das ist ein sehr großer Bereich der Forschung im Bereich Bewegungstherapie bei onkologischen Erkrankungen.
Die Prävalenz ist hoch. Sehr viele Personen leiden unter einer Fatigue. Und das ist auch dieser sogenannte Teufelskreis aus Bewegungsmangel und Erschöpfung. Wenn ich unter einer Fatigue-Symptomatik leide, ist meist die logische Folge, dass ich meine Aktivität reduziere. Daraus folgt der Abbau von Muskulatur, zusätzlich begünstigt durch die Therapie, die ich bekomme. Ich verliere immer mehr an Leistung, bin müder und reduziere die Aktivität noch weiter. Man kommt eben schlecht raus. Der einzige Ausweg ist Bewegung. Das wirkt erst einmal sehr schwierig, weil gerade die, die am schwersten von einer Fatigue betroffen sind, sich natürlich schwertun, sich zu bewegen. Aber die Studien zeigen, dass die Patienten auch am meisten profitieren, wenn man es irgendwie schafft, die Person dazu zu bekommen, sich zu bewegen. Dann wird dieser Kreislauf durchbrochen.
Fußball: FC Prostata
Noch mal zum Thema Prostata. Es gibt den FC Prostata, eine dänische Fußballmannschaft, die sich eben gegründet hat. Das sind alles Menschen mit Prostatakarzinomen, 20 Prozent von denen hatten sogar Knochenmetastasen. Sie waren alle ein halbes Jahr unter Androgendeprivationstherapie. Es gibt inzwischen viele Folgestudien an diesem Fußballverein, auch längere Beobachtungszeiträume über fünf Jahre. Man hat sich angesehen, wie sich dieses regelmäßige Fußballtraining auf viele medizinische Kriterien auswirkt, zum Beispiel auf die Knochenstrukturen, also die Knochendichte, auf Muskeln, aber auch auf psychische Faktoren wie depressive Stimmung oder Angst.
Was man da sieht, ist natürlich sehr klein, aber es soll einfach nur zeigen: Oben sind die Teilnehmenden des FC, unten eine Kontrollgruppe, die nicht trainiert hat. Da sind unterschiedliche Knochenstrukturen abgetragen. Es gab bei allen einen Zuwachs der Knochendichte und das gleiche Schaubild könnte man auch für die Muskelmasse zeigen. Auch die psychische Gesundheit hat sich im Vergleich verbessert. Das heißt, auch wenn man jetzt sagt, ich möchte meine alte Sportart ausüben, die ich früher gemocht habe, beispielsweise Fußball spielen, und nicht in ein strukturiertes Krafttraining-Programm gehen, hat man auch sehr positive Effekte.
Warum bewegen sich viele zu wenig?
Wir haben viel davon gehört, dass die Prognose durch Bewegung verbessert wird. Man hat eine verbesserte Lebensqualität und es gibt gewisse Empfehlungen. Aber wie Sie sich denken können, sind eben nur ein Viertel bis vielleicht 40 Prozent der Menschen mit Krebserkrankungen so aktiv, wie es die Empfehlungen sagen. Das sind die Selbstberichte. Das heißt, man hat Menschen gefragt: „Wie aktiv sind Sie?“ Wenn man das objektiv mit Fitnessuhren misst – wir nutzen auch solche Brustgurte für die Messung der Aktivität –, sind es sogar nur 15 Prozent. Zusätzlich gibt es noch einen Abfall während der Therapie. Wenn man sich ansieht, wie ist es nach der Diagnose oder nach der Therapie aussieht, geht die Aktivität noch einmal herunter.
Eigentlich wäre die Lage klar, aber ist es der innere Schweinehund? Ist es eine Unsicherheit, weil ich vielleicht nicht weiß, was ich mir mir zumuten kann? Sind auch auf der Seite der Behandelnden strukturelle Barrieren, zu wenig Zeit, fehlende Angebote? Oder wird einfach wenig beraten? Da ist die Forschungslage noch sehr dünn. Wir haben uns das im Heidelberger Momentum-Projekt angesehen, das von Karen Steindorff, Joachim Wiskemann und Monika Sieverding eingeworben wurde und von der Deutschen Krebshilfe gefördert wird.
Die Fragen waren:
- Warum sind viele Krebserkrankte nicht ausreichend aktiv?
- Was sind die Haupthinderungsgründe?
- Wie läuft das in den Behandlungsgesprächen?
- Welche Einstellungen stehen dem entgegen?
- Welche Barrieren gibt es?
Wir haben 900 Personen im Bereich des medizinischen Fachpersonals intensiv befragt, sowohl Pflegekräfte als auch Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner und Fachärzte, aber auch Krebspatientinnen und -patienten. 400 Personen hatten Prostatakrebs, 400 Darmkrebs und 400 Frauen Brustkrebs. Wir haben auch längsschnittliche Analysen gemacht und solche Aktigrafen eingesetzt. Das ist ein Brustgurt, den man tagsüber trägt, wo man die Bewegungsprofile objektiv bekommt und nicht auf die Selbstberichte angewiesen ist. Das heißt, wir haben viele verschiedene Themen betrachtet.
Ich möchte noch auf diese Frage der Empfehlung eingehen, weil das ein möglicher Grund ist, der dazu führen kann, dass Unsicherheiten bestehen oder Thema einfach nicht im Fokus steht. Das war eine Beobachtung von meiner Kollegin Nadine Ungar vor zehn Jahren, aber das war der Auslöser, dass wir diesen Projektantrag gestellt haben. Ich lese es mal vor:
Ein älterer Krebspatient stieg die Treppe zum NCT, das ist das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen, in Heidelberg hinauf. Er atmete schwer. Als ich an ihm vorbeikam, sagte er zu mir: „Ich bin weit gekommen. Ich kann noch die Treppe hochgehen. Ich werde nicht den Aufzug benutzen.“ Als er an der Rezeption ankam, war das Erste, was die medizinische Fachangestellte sagte: „Nächstes Mal nehmen Sie den Aufzug.“ Nachdem sie die Formalitäten erledigt hatten, betonte sie bei der Verabschiedung noch einmal: „Vergessen Sie nicht, das nächste Mal den Aufzug zu benutzen. Er ist direkt dort.“ Das ist ein Einzelfallbeispiel, das kann man nicht generalisieren, aber die Frage war schon: Wie sehr hat dieser Paradigmenwechsel von „Schonen Sie sich, Sie brauchen die Energie für die Therapie" hin zu: “Man weiß, es gibt eine gute Evidenz, dass die Menschen sich bewegen sollen” schon stattgefunden. Und: Wie stark wird das wirklich empfohlen? Wir haben uns im Momentum-Projekt, aber auch in anderen Studien, angesehen: „Wie sind die Empfehlungsraten?"
Das kann man auf verschiedene Weise machen. Wir haben mit Fallbeispielen gearbeitet. Wir haben etwa 900 Ärztinnen und Ärzten sowie Fachpersonal Fallbeispiele geschickt. Da ist dargestellt: Ein 70-jähriger Mann hat ein Prostatakarzinom, er hatte eine Strahlentherapie und fragt sie: „Was kann ich denn zusätzlich tun zur Behandlung noch tun?“ Sie sollten offen antworten. Wir haben die Antworten ausgezählt – das war viel Arbeit: Wie häufig kommen die körperliche Aktivität oder Ernährung und andere unterstützende Dinge vor. Es kamen in 70 Prozent der Fälle die Worte Bewegung, Sport, Aktivitätsempfehlung oder ähnliche Begriffe vor. Unter Krebsbetroffenen wiederum berichten höchstens 30 Prozent davon, dass in einem der Arztgespräche das Thema gefallen ist.
Das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Es ist eine stressige Situation. Man erinnert sich vielleicht nicht an jedes Wort, das die Behandelenden gesagt haben. Es kann aber auch sein, dass hier eine Diskrepanz vorliegt. Das kann man nicht abschließend sagen. Es kamen aber auch sehr viele Barrieren zum Vorschein, die von medizinischem Fachpersonal geäußert wurden, zum Beispiel:
- Es fehlen hier kontaktierbare Experten.
- Ich bin unsicher, ob der Patient Sport machen darf.
- Ich kann es nicht abrechnen.
- Es fehlt eine spezifische Richtlinie.
Daraufhin haben wir die Unterstudien noch tiefergehend betrachtet: Was ist eigentlich mit der Tiefe der Beratung? Spricht es jemand kurz an oder geht es weiter? Zum Beispiel mit der Vermittlung in geeignete Programme. Dass gesagt wird: „Hier sind Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner. Hier ist ein Netzwerk, hier können Sie sich informieren.“ Es gibt ein 5A-Framework. Das ist auf Englisch schön, weil alle Begriffe mit „A" beginnen:
- Assess, nachfragen. Bewegen Sie sich eigentlich?
- Advice, eine Empfehlung geben, zum Beispiel dieses Krafttraining und die 30 Minuten Ausdauer. Bis hin zu: Wir besprechen das beim nächsten Termin.
- Wie kann es in Ihren Alltag übergehen?
- Was haben Sie für Vorlieben, was für Sportarten haben Sie früher gemach? Wie können Sie das integrieren? Hier wäre ein Sportprogramm
- Eine tiefergehende Beratung. Etwa 30 Prozent der Patienten bekommen gar keine Beratung. Das Thema ist gar nicht präsent im Beratungsalltag.
So eine Basisberatung, bei der jemand nachfragt oder sagt, dass es gut wäre, wenn sie sich mehr bewegen, gibt es fast bei der Hälfte. Eine tiefergehende Beratung bekommt nur eine Minderheit. Das heißt also, es wäre toll, wenn man da einen Schulterschluss hinbekommen könnte, dass Ärzte auch wissen, dass es in der Nähe dieses und jenes Angebot gibt. Auf diesen Seiten kann ich mich informieren, oder zu Fachleuten weiterleiten.
Denn natürlich ist die fehlende Beratung ein Zeitproblem. Es ist idealistisch, zu sagen, dass in jedem Arztgespräch eine tiefergehende Beratung stattfinden sollte. Ich hatte überlegt, ob ich einen Exkurs mache mit einem psychologischen Modell. Denn es ist aus unserer Sicht sehr wichtig, zu sehen, wo Personen in ihrer Motivation, in ihrer Zielsetzung stehen und wie kann man ihnen helfen kann, in die Umsetzungsphase? Das ist so ein Prozessmodell. In unseren Studien adressieren wir verschiedene Stellschrauben. Ich hatte die Selbstwirksamkeit schon angesprochen. Das ist ein zentraler Baustein. Wenn Menschen glauben, dass sie nicht die Möglichkeiten, nicht die Fähigkeiten, haben, selbst etwas zu beeinflussen und ein Ziel zu erreichen, wird es schwierig.
Das ist auch der Fall, wenn ich keine Ergebniserwartung habe. Wenn ich nicht weiß, dass Sport helfen würde, zum Beispiel ein Beckenbodentraining, um die Inkontinenz zu verbessern, dann werde ich das auch nicht ausführen. Der Schweinehund sitzt eher im hinteren Bereich. Wenn ich es nicht plane, wenn ich mir nicht vornehme, wann, wo und mit wem, werde ich kein Krafttraining machen oder Radfahren gehen. Wenn ich die Barrieren nicht einplane, zum Beispiel:
- An den Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, mache ich etwas anderes.
- Wenn ich nicht aus dem Haus gehen will, mache ich das zu Hause.
- Wenn das Wetter schlecht ist, gehe ich ins Hallenbad.
Sich für den Plan B Gedanken zu machen, hilft, von der Zielsetzung zum Verhalten zu kommen. Das Problem der geringen Selbstwirksamkeit hat meine Kollegin Nadine Ungar in einer Studie intensiv betrachtet. Es gibt nicht nur in der Theorie, sondern auch mit viel Evidenz verschiedene Stellschrauben, wie ich meine Selbstwirksamkeit steigern kann. Zum Beispiel beim Thema Sport und Krebs: Vielleicht führe ich ein Erfolgstagebuch und gucke: Was habe ich schon geschafft? Welche kleinen Schritte waren positiv?
Was wir in der Studie von Nadine Ungar auch betrachtet haben, war, dass bereits aktive Krebspatientinnen toll als Rollenmodelle fungieren können, davon berichten können und sagen: „Ich habe das so und so geschafft.“ Wir haben auch Treffen arrangiert, bei denen sich im Raum Heidelberg bereits körperlich aktive Krebspatienten mit Personen getroffen haben, die vorher inaktiv waren. Sie haben sich gemeinsam bewegt und von ihren Erfahrungen berichtet.
Infos und Adresse für mehr Bewegung
Was ich zum Abschluss noch zeigen möchte: Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, das auszuprobieren: Wo kann ich mich informieren? Auf der Seite der Prostatahilfe ist viel Tolles im Bereich Bewegung und Krebs. Das Netzwerk OncoAktiv ist ebenfalls super. Das hat Joachim Wiskemann, der auch am Momentum-Projekt beteiligt war, weiterverfolgt. Es ist wie eine Sammlung mit Postleitzahlsuche. Sie können wohnortnah sehen, was gibt es in Ihrer Region an sehr guten Zentren für Bewegungen bei Krebserkrankungen gibt. So dass sie auch abklären können, was Sie machen dürfen. Was gibt es vielleicht für Kontraindikationen? Wenn es in Ihrem Ort kein Angebot gibt, bemühen die Menschen im Netzwerk sich darum und haben Kooperationspartnerinnen und -partner. Das Netzwerk ist größer, als es auf der Deutschlandkarte aussieht. Da können sie sich einfach beraten lassen und Angebote finden, wenn Sie Interesse haben.
Es war auch in unserer Momentum-Studie vielen Behandelenden klar, dass man eigentlich handeln müsste. Man müsste die Bewegung wie eine Medizin verschreiben. Man müsste sich ansehen: „Wie sieht der Trainingsplan aus?“, „Wie könnte man das in die Therapien und auch in den Alltag der Patienten einpassen?“ Das wäre toll, aber es ist häufig ein Zeitproblem.
Fazit:
Wir haben super viele positive Aspekte von körperlicher Aktivität bei Krebserkrankungen und jenseits der ganzen Evidenz: Dass man selbst etwas beitragen kann, dass man selbst die Kontrolle hat, dabei Spaß hat und sich wieder lebendig fühlt. Dass eben nicht alles mit einem passiert. Das ist sehr wichtig. Der Sport ist mehr als nur gut für den Körper. Er ist einfach für alle Bereiche relevant.
NutzerfragenModerator: Ich würde gerne noch mal einen Bereich ansprechen wollen, der ganz zum Schluss kam: Benefits. Die Vorteile, die man hat, wenn man grundsätzlich Sport macht und wenn man trainiert ist, bevor es möglicherweise zum Fall der Fälle kommt. Sie hatten es eben auch erwähnt, die Gruppen, die zusammen sind, die Krebspatienten miteinander. Ich erlebe das seit vielen Jahren. Von der Stiftung Leben mit Krebs gibt es Rudern gegen Krebs. Das findet auch in Kiel und in Lübeck statt. Ich moderiere das seit zehn Jahren. Da sind immer Patienten dabei, die alle aus einer Sporttherapie kommen, während, vor und nach der Krebsbehandlung. Das ist ein ganz irres Miteinander. Sie haben zum Rudern gefunden und feuern sich an und sind viel zusammen, weit, weit nach der Therapie. Wie haben Sie das erlebt mit den Patienten untereinander? Was entwickelt sich dort? PD Dr. Laura Schmidt: Das ist eine tolle Frage. Ich muss sagen, das Momentum-Projekt wurde ursprünglich nur von 2015 bis 2018 gefördert. Wir hatten dann noch ein paar Studien weitergeführt. Schönerweise haben von den Rollenmodellen damals, wir hatten ja einen Aufruf gestartet, haben sie eine Krebserkrankung und sind sportlich aktiv und haben Lust, zur Verfügung zu stehen, als gematchter Trainingspartner? die, die sich gemeldet haben, das fortgeführt. Wir kriegen sogar jetzt manchmal noch eine Postkarte von so einem Team, von Menschen, die weiterhin zusammen Sport machen. Das ist toll, wenn man weiß, dass so was weitergeführt wird. Dieses Netzwerk OncoAktiv ist auch so ein Beispiel. Das hat klein angefangen, aber man merkt, dass immer mehr Kooperationspartner in ganz Deutschland dazukommen, weil es so wichtig ist, dass man auch peripher Angebote hat. Viele sagen: „Ich komme zu Ihnen nach Heidelberg, hier am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen habe ich alles, und dann fahre ich wieder eine Stunde zurück in den Odenwald und weiß gar nicht, was ich machen kann." Das zu sammeln und zu wissen: Es gibt eine Anlaufstelle. Ich kann dort, wenn ich nichts finde, anrufen und die wissen oft noch mehr oder vermitteln, das ist super wertvoll und sollte in jedem kleinen Ort, auch im Odenwald, weitergeführt werden. Moderator: Man profitiert davon, klar, man macht Sport. Das ist der eigentliche Hintergrund. Aber durch das Miteinander und den Austausch, das bringt einen doch sicherlich viel weiter. PD Dr. Laura Schmidt: Ja, vor allem, weil es so eine aktive Rolle ist. Es gibt sehr viele Arten von Selbsthilfegruppen, die toll funktionieren. Da ist aber der Fokus auf etwas Positivem, das ist auch das Schöne. Klar kann man sich dabei auch über Probleme austauschen, Aber der Fokus ist auf: Ich setze mir ein Ziel, ich versuche es umzusetzen und wenn ein Rückschlag da ist, dann habe ich wen, mit dem ich es besprechen kann und ich kann einen neuen Anlauf machen. Das sollte man auch einplanen. Es wird immer kleine Rückschläge geben und wenn man das weiß, dass man anknüpfen kann an vorherige Erfolgserlebnisse, fällt es leichter, wieder zu starten. |