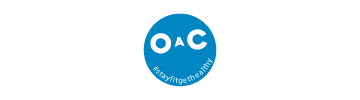Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Prostataerkrankungen: Was muss Mann wissen?
10. Oktober 2025 | von Redaktion Prostata Hilfe DeutschlandWo liegt die Prostata? Was hat es mit der gutartigen Prostatavergrößerung auf sich? Wie wirkt sich ein Prostatakarzinom aus? Und wer ist betroffen? Diese Fragen beantwortet der Urologe Dr. Frank Schiefelbein.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden.
Wenn Sie dieses Modul sehen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an.
Dr. Frank Schiefelbein: Um zu verstehen, welche Erkrankungen der Prostata es gibt und wie wir das Ganze einordnen können, werde ich zunächst auf die Anatomie und die Funktion der Prostata eingehen. Was macht die Prostata überhaupt? Und wofür haben wir Männer die Prostata? Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Erkrankungen an der Prostata, die für jeden Mann von Bedeutung sein können, vor allen Dingen im Hinblick auf die Früherkennung von Prostatakrebs, aber auch als Betroffener der gutartigen Vergrößerung der Prostata – wir müssen nur alt genug werden, dann sind wir betroffen.
Beim Prostatakrebs möchte ich auf die Häufigkeit der Erkrankungen eingehen, auf die Altersverteilung, auf Risiken, auf Sterblichkeit und eine der ganz großen Besonderheiten beim Prostatakarzinoms, das breite Spektrum an sehr unterschiedlicher Aggressivität. Dieses breite Spektrum bestimmt die Möglichkeiten der Therapie. Zum Schluss kommt eine Zusammenfassung, damit Sie wissen, welche Informationen für Sie wichtig ist.
Prostata: Anatomie
Wenn wir uns die Prostata anschauen, dann ist das ein Organ, das etwa so groß ist wie eine Walnuss. Dieses Organ ist die Vorsteherdrüse. Sie ummantelt die Harnröhre und sitzt unterhalb der Harnblase. Wir sehen, das Organ sitzt leider am tiefsten Punkt im menschlichen Becken. Es ist auch für uns als Mediziner nicht so einfach, dieses Organ zu behandeln, zum Beispiel bei einer Operation oder bei einer Bestrahlung. Denn die Prostata sitzt hinter dem Schambein, hinter dem Knochen und unterhalb der Blase. Die Prostata und die Samenbläschen bilden zusammen eine anatomische Einheit, aber auch eine funktionelle Einheit. Nach hinten ist der Enddarm und unterhalb der Prostata, direkt unterhalb, ist die Schließmuskelregion. Es ist für uns eine große Herausforderung, ein solches ein Organ zu behandeln, denn keine der anderen Strukturen darf verletzt werden und es besteht eine unmittelbare Nachbarschaft.
Die Funktion der Vorsteherdrüse ist die Produktion eines Sekrets. Das macht deutlich, dass wir hier an einer Grenzfläche sind. Wir haben einerseits den Harntrakt, andererseits haben wir den Fortpflanzungsbereich des Mannes. Im Hoden werden die Spermien gebildet, im Nebenhoden reifen sie heran. Über den Samenleiter gehen sie dann zur Stelle am Übergang der Prostata und der Samenbläschen. Die Prostata produziert ein Sekret, und dieses Sekret ist wichtig für die Ernährung der Spermien.
Am Ort des Samenergusses wird die Samenflüssigkeit, die von den Samenbläschen kommt, mit diesem Prostatasekret vermischt. Es ist sehr wichtig für die Energie der Spermien. Ohne Prostata könnten wir Männer uns nicht fortpflanzen. Es ist kein lebenswichtiges Organ. Wir können auch gut ohne Prostata leben und - wie Sie gleich hören werden – sogar einen Ironman machen.
Die Prostata hat also als wesentliche Funktion eine Fortpflanzungsfunktion. Sie:
- gehört zu den inneren Geschlechtsorganen des Mannes.
- ist eine Drüse
- produziert das Sekret für die Spermienbeweglichkeit
- ist der Ort des Samenergusses
- Kurz gesagt: ohne Prostata gibt es keine Zeugungsfähigkeit. Das sind die Dinge, die wir uns merken sollten.
Interview “Für Prostataerkrankungen müssen wir nur alt genug werden”, sagt der Urologe Dr. Frank Schiefelbein. |  |
|---|
Prostatavergrößerung
Ich komme jetzt zur gutartigen Prostatavergrößerung und zu den Grundlagen dieser Erkrankung. In der Mitte der Prostata bildet sich dabei eine gutartige Gewebeneubildung, welche die Harnröhre umschließt. Diese Neubildung von Gewebe wird also nicht von bösartigen Zellen geformt, sondern von rein gutartigen Zellen. Die gutartige Prostatavergrößerung hat mit der bösartigen Prostataveränderung, dem Prostatakarzinom, nichts zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen, die man auch unterschiedlich behandeln muss. Diese gutartige Prostatavergrößerung drückt praktisch, wenn Sie so wollen, auf die eigentliche Drüse und drückt sie mehr und mehr auseinander.
Wenn das Wachstum im Alter weiter voranschreitet, dann ist seitlich kein Platz mehr, sondern das Ganze wächst in Richtung Harnblase. Man das kann sehr gut mit Ultraschalluntersuchungen sehen. Der Blasenboden wird nach oben gedrückt. Das Ganze verursacht gewisse Symptome, die wir spüren. Die Einengung der Harnröhre führt vor allem dazu, dass wir schlechter Wasser lassen können. Der Harnstrahl wird dünner. Die Harnblase muss sich unter Umständen mehr anstrengen, um Druck auszuüben, damit der Urin auch über dieses Hindernis der eingeengten Harnröhre abfließen kann. Unter Umständen kann ein Rest in der Harnblase bleiben oder die Blase sich nicht mehr richtig entleeren. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Harnverhalt und zu einem Aufstau von Urin in den oberen Harntrakt kommen. Das heißt, dass unsere Nieren den Urin nicht mehr in die Blase befördern können, weil die Blase voll ist und die Nieren unter Umständen ihre Arbeit nicht mehr richtig verrichten können. So kann es zu einer Niereninsuffizienz kommen. Das sind die wesentlichen Symptome.
Noch einmal zusammengefasst:
- Wenn die Prostata größer wird, kann es schwierig sein, die Harnblase vollständig zu entleeren.
- Wir müssen vielleicht häufiger zur Toilette.
- Es sind kleinere Mengen Wasser, die wir nur aus der Blase entleeren können. Vor allen Dingen nachts kann das stören, die Nachtruhe kann wirklich gestört werden.
- Der Urinstrahl ist schwächer.
- Wir haben womöglich Schwierigkeiten, die Blase zu entleeren - gerade beim Beginn des Wasserlassens, vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden. Denn dann ist die Blase von der Nacht voll. Das sind Anlaufschwierigkeiten oder Startschwierigkeiten,
- auch ein störender, dauernder Harndrang kann auftreten, welche die Lebensqualität erheblich einschränken können.
Wie häufig kommt das vor?
In Deutschland leben etwa zwölf Millionen Männer über 50 Jahre. Und ab 50 Jahren, das kann man sich gut merken, sind etwa 50 Prozent der Männer betroffen, also jeder zweite. Ab 70 Jahren sind es über 70 Prozent. Je älter wir werden, umso wahrscheinlicher ist es, mit der gutartigen Prostatavergrößerung behaftet zu sein. Von der Behandlungspflichtigkeit her ist es so, dass bereits ab dem 50. Lebensjahr etwa jeder dritte Mann eine behandlungsbedürftige gutartige Prostatavergrößerung hat.
Damit Sie sich das vorstellen können: Das Durchschnittsvolumen der Prostata liegt bei einem Mann um die 50 Jahren etwa bei 24, 25 Millilitern. Das steigt bei Männern um die 75 auf 38 Milliliter an. Allerdings hat die Prostatagröße eine unglaublich hohe Variabilität. Die größte Prostata, die ich als gutartige Prostatavergrößerung operativ entfernt habe, hatte 480 Gramm. Das ist selten. Eine solch große Variabilität kommt vor. Es gibt auch Prostatas von über 100 Gramm . Damit haben wir als Operateure ebenfalls zu tun.
Was sind die Ursachen der Prostatavergrößerung?
Die Hauptursache ist zunächst ungeklärt. Warum kommt es zu dieser Prostatavergrößerung? Richtige Beweise, um feststellen zu können, dass es nur eine Ursache gibt, haben wir nicht. Aber die Hauptursache liegt wahrscheinlich in der Änderung des Hormonstoffwechsels im Lauf des Lebens.
Wir wissen, dass auch beim Mann die männlichen Sexualhormone mit dem Alter langsam und kontinuierlich abnehmen. Das Verhältnis von Testosteron – dem männlichen Sexualhormon – und dem Östrogen – das ist das weibliche Sexualhormon – verändert sich. Männer haben sowohl Testosteron als auch Östrogenn, allerdings in einer deutlich geringeren Konzentration. Das Zusammenspiel dieser beiden Hormone – das Verhältnis zueinander – kann ausschlaggebend sein, um das gutartige Gewebewachstum in der Prostata zu stimulieren.
Östrogen haben wir Männer auch, vor allem wenn wir etwas wohlbeleibter sind. Vor allem die Fetteinlagerung im Bauchraum spielen eine Rolle. Je mehr Fetteinlagerungen wir haben, desto höher ist häufig der Östrogenspiegel beim Mann. Das stimuliert die gutartige Prostatavergrößerung. Auch die Ernährung spielt eine Rolle, vor allem der Alkoholkonsum. Denn Alkohol wird in der Leber verstoffwechselt. Wenn die Leber erst einmal damit zu tun hat, Alkohol zu verstoffwechseln, kann sie den Östrogenspiegel weniger verändern. Der Östrogenspiegel ist also bei Alkoholikern höher. Ein weiteres Risiko liegt bei chronischen Entzündungen der Prostata vor.
Vergrößerte Prostata Lesen Sie die wichtigsten Infos über die Ursachen, Symptome und Behandlungen bei einer beningnen Prostatahyperplasie. |  |
|---|
Prostatakrebs
Prostatakrebs sitzt nicht wie bei der Prostatavergrößerung in der Innendrüse, sondern in der Außendrüse. In über 70 Prozent ist der Tumor dem Enddarm zugewandt. Daher stammt auch die traditionelle Untersuchung des Urologen: Das Abtasten der Prostata über den Enddarm, um letztendlich Gewebeveränderungen und Gewebeverhärtungen zu ertasten. Prostatakrebs bildet häufig nicht einen, sondern mehrere Herde. Diese Herde können von der Gewebedifferenzierung und von der Aggressivität her unterschiedlich sein. Mancher Herd ist etwas größer, kann aber wenig aggressiv sein. So ist ein Gleason-6-Tumor ein nicht so aggressiver Tumor. Direkt daneben ist vielleicht ein kleinerer Herd, dieser jedoch aggressiv ist. Die Prognose des Patienten wird nicht durch den größeren Herd bestimmt, sondern durch den kleineren. Denn der aggressive Herd hat unter Umständen später ein ganz anderes Wachstum und eine größere Ausbreitungswahrscheinlichkeit.
Sehen wir uns die Zahlen einmal näher an:
- Prostatakrebs ist der häufigste Krebs des Mannes. Wir haben im Jahr etwa 65.000 Neuerkrankungen und leider 15.000 Todesfälle im Jahr.
- Der Altersdurchschnitt zum Zeitpunkt der Erkrankungsdiagnose liegt im Deutschland bei knapp über 70 Jahren. 80 Prozent der erkrankten Männer sind älter als 60 Jahre.
- Von der Lebenswahrscheinlichkeit her erkrankt einer von acht Männern im Laufe des Lebens am Prostatakarzinom.
- Etwa einer von 30 wird an dieser Erkrankung leider auch versterben.
- Das Risiko, in den nächsten zehn Jahren zu erkranken, ist, wenn wir jung sind, eher niedrig – und steigt mit zunehmendem Alter an.
- Wenn wir uns die Statistik vom Robert-Koch-Institut anschauen, sehen Sie, dass der Prostatakrebs – analog zum Brustkrebs bei Frauen – der häufigste Tumor ist. Jeder vierte Tumor des Mannes betrifft die Prostata.
Medizinisch ist das eine große Herausforderung. Wenn wir uns aber die Sterblichkeitsstrukturen anschauen, sehen wir, dass der Prostatakrebs auf den dritten Platz rutscht. Der Tumor ist in der Regel gut behandelbar. Er ist so gut behandelbar, dass die Patienten, obwohl es der häufigste Tumor ist, meist nicht am Prostatakarzinom sterben. Die meisten Männer sterben mit dem Prostatakrebs, aber nicht am Prostatakrebs. Das ist im Wesentlichen auf die deutlich verbesserten Behandlungsmöglichkeiten zurückzuführen.
Sehen wir uns dafür noch einmal die Zahlen an: Das ist ein typisches Merkmal, die 5-Jahres-Überlebenszeit und die 10-Jahres-Überlebenszeit nach einer Tumorerkrankung. Wir sehen, dass beim Prostatakrebs über 90 Prozent der Patienten nach 5 und auch nach 10 Jahren noch leben. Wir haben also eine sehr, sehr gute Prognose. Im Gegensatz zum Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem Pankreaskarzinom, der eine schlechte Prognose hat. Bei der Behandlung haben wir leider noch keine vergleichbaren Therapieerfolge.
Schauen wir uns noch einmal die Altersverteilung an. Wir sehen, dass der Prostatakrebs vor dem 50. Lebensjahr eher selten ist. Der jüngste Patient, den ich mit einem Prostatakrebs operativ behandelt habe, war 37 Jahre alt. Da waren Vater, Großvater und später ein Bruder des Patienten betroffen. Das macht dann das Risikoprofil aus.
Sehen wir uns die Demografie an. Wir sehen in einer Statistik aus dem Jahr 2022, dass die Babyboomer jetzt um die 60 Jahre alt sind. Wir sehen, wie viele tausend Personen das betrifft. Wir sehen, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine Zunahme an Prostatakrebspatienten zu erwarten haben – allein durch die Tatsache, dass die geburtenstarken Jahrgänge in diese Altersstruktur kommen werden. Das ist auch für uns Urologen eine besondere Herausforderung für die Zukunft.
Sterberisiko – was bedeutet das?
15.000 Männer sterben jedes Jahr in Deutschland am Prostatakarzinom. Sehen wir uns die Krebstodes-Statistik und die der Tode durch den Straßenverkehr an. Das Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, ist ungefähr sechsmal höher ist als im Straßenverkehr.
Welche Risiken sind bekannt? Welche Risiken sind bewiesen?
Das Hauptrisiko ist das Alter. Je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es, generell eine Krebserkrankung zu erleiden. Das trifft insbesondere auf das Prostatakarzinom zu. Wir haben die Altersverteilung gesehen und kurz die genetischen Faktoren angesprochen. Wie hoch sind die genetischen Faktoren? Etwa zwölf Prozent der Prostatakarzinome sind auch genetisch bedingt sind. Wir können das anhand der Versorgungsstatistiken sehr gut erfassen.
- Haben wir einen betroffenen Bruder, steigt das Risiko auf 2,9.
- Mit einem betroffenen Vater ist das Risiko doppelt so hoch wie in der allgemeinen Bevölkerung.
- Haben wir zwei betroffene Verwandte in erster Linie – Vater und Bruder – kann das Risiko bis zum Fünffachen steigen.
Eine Besonderheit ist, dass die Patienten, die eine genetische Belastung haben, häufig jünger sind. Außerdem wissen wir, dass diese jüngeren Patienten mit einem Prostatakarzinom häufig die Neigung haben, aggressivere Tumore zu bilden. Von daher ist es sehr wichtig, diese Patientengruppe in der Früherkennung rechtzeitig zu erkennen und sie vor schwerem Schaden zu bewahren, indem wir sie rechtzeitig behandeln.
Betrachten wir die Hautfarbe eines Menschen, vor allen Dingen die dunkle Haut. Bei afroamerikanischen Patienten, die wir in Süddeutschland häufiger hatten, spielt das eine Rolle. Durch den Besetzungsstatus hatten wir in Bayern viele amerikanische Soldaten, auch viele afroamerikanische Soldaten, die betroffen waren.
Ein weiterer Faktor: Bei BRCA-Trägern – BRCA steht für Breast Cancer – sind die Reparaturmechanismen der Zellen im Körper gestört und Krebs kann entstehen. In der Forschung hat sich gezeigt, dass das Faktoren sind, die wir bestimmen können. Sie sind auch beim Brustkrebs der Frau ein möglicher Krankheitsmechanismus. Auch wenn die Mutter oder die Großmutter Brustkrebs hatte, ist das Risiko für die männliche Nachkommenschaft statistisch erhöht, an einem Prostatakarzinom zu erkranken. Deswegen ist es für uns, die wir uns mit Tumorerkrankungen beschäftigen, wichtig, in der Krankengeschichte alle Krebserkrankungen des Patienten in seinem familiären Umfeld aufzunehmen, um ein individuelles Risikoprofil erstellen zu können.
Die Ernährung spielt ebenfalls eine Rolle. Generell ist die Ernährung für unseren körpereigenen Schutzt, also für das Immunsystem, wichtig. Denn eine Krebserkrankung bekommt man auch, wenn unser Immunsystem oder das Reparatursystem, das krankhafte beziehungsweise schadhafte Zellen im Körper erkennen soll, versagt. Je mehr Giftstoffe wir dem Körper zuführen, durch Alkohol oder Nikotin, umso eher schädigen wir unser Immunsystem. Von daher spielt das eine große Rolle.
Prostatakarzinom Erfahren Sie die wichtigsten Infos über die Ursachen, Symptome, Diagnose, Therapien und Prognose bei Prostatakrebs. | 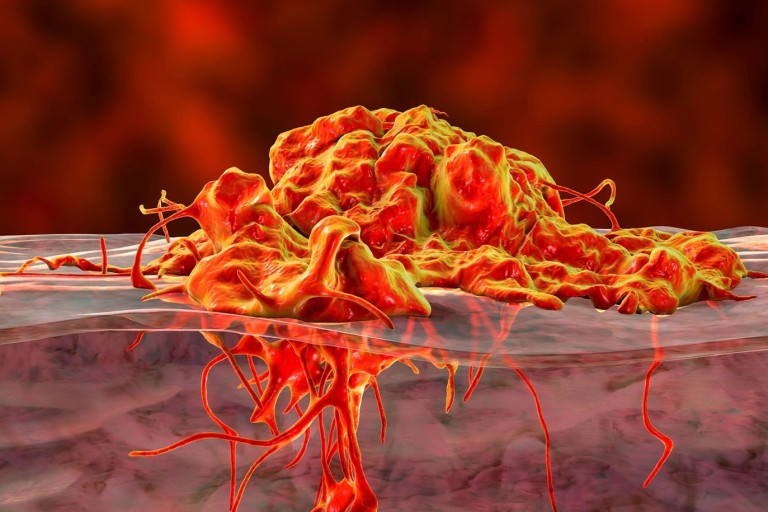 |
|---|
Frühsymptome
Bei Prostatakarzinomen gibt es kein Frühsymptom, bei dem wir sagen können, das ist ein Krankheitszeichen. Bei diesem müsst ihr aufpassen, da müsst ihr zum Urologen gehen. Deswegen ist es so wichtig, deswegen plädieren wir dafür, dass wir im Laufe unseres Lebens relativ früh, ab 40 oder 45 Jahren – je nach familiärer Belastung – einmal zur Früherkennung gehen. Um das individuelle Risiko möglichst frühzeitig zu ermitteln und um die individuelle Vorsorge, also die Früherkennungstermine festzulegen. Die Termine können nach zwei oder nach fünf Jahren sein, nicht jährlich. Später können die Intervalle unter Umständen angepasst und gestreckt werden.
Stadien
Es gibt drei Stadien, die wir uns merken müssen. Es gibt den örtlich begrenzten Prostatakrebs, der häufig ein langsames Tumorwachstum mit einer guten Prognose aufweist. Dies gilt vor allem, wenn er nicht aggressiv ist, aber das können wir sehr gut über den Gewebebefund bestimmen. Häufig reicht es, die Erkrankung zu beobachten, um die Aggressivität bewerten zu können. Mancher Patient muss gar nicht sofort behandelt werden, sondern man kann die Erkrankung erst einmal beobachten. Ziel ist es, mit der Therapie noch möglichst lange abzuwarten beziehungsweise den Patienten sogar vor einer Therapie zu bewahren.
Dann gibt es das örtlich fortgeschrittene Prostatakarzinom. Durch Operation oder Bestrahlung beispielsweise ist eine Heilung noch möglich. Und wir unterscheiden das metastasierte, fortgeschrittene Prostatakarzinom, bei dem es Absiedelungen des Tumors im Lymphknotenbereich, in Knochen oder der Lunge gibt. Hier können wir den Patienten nicht mehr vollständig heilen, aber wir können das Tumorwachstum lokal eindämmen und wir können vor allem versuchen, die Lebensqualität des Patienten lange zu erhalten. Die Fortschritte in der medikamentösen Tumortherapie, gerade in den letzten Jahren, sind enorm, so dass wir Gott sei Dank auch in diesem Erkrankungsstadium eine erhebliche Lebenszeitverlängerung haben. Wir machen auch für den Patienten eine gute weitere Lebensperspektive deutlich.
Noch einmal zur Vergegenwärtigung:
- Im frühen Stadium ist zum Beispiel ein einzelner Tumorknoten in der Prostata. Der Tumor verursacht noch keine Symptome, weil er die Prostatafunktion nicht stört. Wird dieser Knoten größer, drückt er unter Umständen auf die Harnröhre. Ähnlich wie bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata ist es so, dass der der Harnstrahl dünner wird und das Wasserlassen erschwert werden kann. Wenn dieser Tumorknoten die Prostata infiltriert, kann das auch zu Blutungen führen. Vor allen Dingen beim Samenerguss, kann das ein blutiger Samenerguss werden. Das kann das erste Symptom eines solchen Knotens darstellen.
- Ein Beispiel für die Metastasierung: Prostatatumore sind generell, wie andere Tumore auch, gut durchblutet. Diese Tumorzellen können sich irgendwann an die Wände der Gefäße anheften, diese durchdringen und über die Blutbahn oder Lymphbahn nach außen gelangen und Metastasen bilden.
Die Prognosekriterien sind gut, wenn der Tumor auf das Organ begrenzt ist, wenn der Gleason-Score nicht so aggressiv ist, der PSA-Wert möglichst unter zehn ist, keine Metastasen vorliegen, möglichst keine Familienanamnese vorhanden ist und wir schon etwas älter sind. Schlechtere Prognosekriterien sind es, wenn der Tumor organüberschreitend ist und der Gleason-Score schlechter ist, wenn also eine 4 oder 5 vorne steht. Das sind die aggressiven Anteile. Auch wenn der PSA-Wert bei über 20 liegt, Metastasen vorliegen oder eine positive Familienanamnese vorhanden ist, sind die Prognosekriterien ungünstiger. Je jünger der Patient ist, desto vorsichtiger muss man sein, denn der Tumor ist aggressiver.
ZusammengefasstWas sollen Sie von diesem Vortrag mitnehmen?
|
NutzerfrageDie vielen Therapiemöglichkeiten und Fortschritte in der Therapie gibt es nur durch Studien, an denen auch Patienten beteiligt sind. Was spricht für diese Studienteilnahme? Denn viele Patienten sagen wahrscheinlich erst einmal: „Da weiß ich nicht, ob ich mitmachen soll." Machen Sie gerne ein bisschen Werbung. Dr. Frank Schiefelbein: Ja, es ist so, dass die Fortschritte in der Medizin bewiesen sein müssen. Deswegen brauchen wir Studien. Ohne Studien haben wir keinen Beweis für eine Therapie. Wichtig ist, dass man sich als Patient mit diesen Studienstrukturen beschäftigt und sich beraten lässt. Aber moderne Therapieverfahren gibt es nur, wenn wir sie erforschen können. Die Studien sind in der Regel so gut vorbereitet, dass sie eine zielgerichtete Möglichkeit aufweisen, wie wir in Zukunft Tumorerkrankungen besser behandeln können. Die Teilnahme an Studien ist ein wesentliches Rückgrat dafür, dass wir auch in Zukunft moderne Medizin betreiben können. |