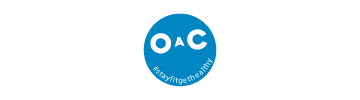Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Ist eine Bestrahlung bei Prostatakrebs eine wirksame Methode?
10. Oktober 2025 | von Redaktion Prostata Hilfe DeutschlandWas kann eine Strahlentherapie bei einem Prostatakarzinom bewirken? Wie wirksam ist eine Bestrahlung überhaupt? Und ist die Strahlentherapie besser verträglich als eine Operation? Diese Fragen beantwortet der Radiologe Prof. Dr. Jürgen Dunst.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden.
Wenn Sie dieses Modul sehen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an.
Prof. Dr. Jürgen Dunst: Bei der Strahlentherapie hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr viel entwickelt. Ich möchte Ihnen aber einen kurzen Überblick gebe, wie faszinierend die Entwicklung in den letzten Jahren war. 1994 war für mich ein ganz besonderes Jahr. Da bin ich an der Universitätsklinik in Halle an der Saale Direktor geworden und ich habe mein erstes Handy gekauft. Meine Frau war schwanger, ich wollte immer erreichbar sein. Dieses Ding, das ich damals hatte, ein Nokia-Handy, war ein toller Apparat, man konnte überall erreicht werden. Dass diese kleine Entwicklung 30 Jahre später unser Leben so verändern würde, hätte keiner von uns gedacht. Heute laufen wir alle mit dem Smartphone herum, da laufen Apps darauf, wir schauen damit Fernsehen oder Filme, wir kommunizieren per WhatsApp oder per E-Mail. Telefonieren tun wir auch. Es gibt KI-assistierte Sprachassistenten, also eine tolle Entwicklung.
Linearbeschleuniger und künstliche Intelligenz
In der Strahlentherapie war es mindestens genauso gut. 1994 kam ein Gerät auf den Markt, ein Siemens-Linear-Beschleuniger. Er konnte zum ersten Mal vor oder während der Bestrahlung ein Bild machen und die Lage des Patienten überprüfen. Allerdings nur mit dem Therapiestrahl, womit man keine diagnostische Qualität bekommt. Das war toll für damalige Zeiten, aber von heute aus betrachtet ist es Steinzeit. Die modernen Geräte, die wir hier haben, die können viel schneller und sicherer bestrahlen. IMRT, das gab es damals noch gar nicht. Sie können die Bestrahlung nur durchführen, wenn die Lagerung des Patienten vorher mit einem CT überprüft wurde. Dieses Gerät macht vor der Bestrahlung immer ein CT und der Arzt muss bestätigen, dass der Patient ganz korrekt liegt. Sonst wird die Bestrahlung nicht freigegeben.
Dieses erste Gerät besitzt auch Künstliche Intelligenz, mit der man die Bestrahlung an die tägliche Anatomie anpassen kann. Die Prostata ändert sich nicht, aber die Füllung von Blase und Darm können sich ändern und das kann kleine Auswirkungen auf die Verteilung der Strahlung haben. Wenn Sie heute also in eine Klinik gehen und bestrahlt werden, werden sie im Regelfall mit einem solchen Linearbeschleuniger bestrahlt.
Da werden Elektronen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und oben kommt der Therapiestrahl raus, 6 Mega-Volt. An der Seite des Geräts ist eine Diagnostikröhre, die sich vor der Bestrahlung ausklappen lässt. Das Gerät dreht sich einmal um den Patienten herum, macht ein CT und kontrolliert dann, ob der Patient, der auf diesem Tisch richtig liegt. Dann wird der Arzt gefragt: Liegt der Patient richtig? Das Gerät macht einen Vorschlag: Diesen Tisch kann man in allen Raumebenen sowohl linear bewegen, also rechts, links, oben, unten, aber auch in allen Raumebenen drehen, drehen, kippen, neigen, sodass man jede Ungenauigkeit der Patientenpositionierung ausgleichen kann. Damit erreichen sie Positionierungsgenauigkeiten von Plusminus einem Millimeter. An diesem Gerät befindet sich eine solche Ausstattung.
Da sind Röntgenröhren im Boden und LED-Detektoren an der Decke, mit denen man mögliche Bewegungen des Patienten während der Bestrahlung kontrollieren kann. Wenn Sie wegen eines Prostatakarzinoms an diesem Gerät bestrahlt werden, bekommen Sie im Regelfall 20 bis 40 Bestrahlungen - meistens 20, bei manchen Erkrankungen auch 40. Die Bestrahlung erfolgt werktags, montags bis freitags jeden Tag einmal. Die ganze Prozedur dauert pro Tag etwa 20 bis maximal 30 Minuten - vom Betreten des Bestrahlungsraums bis zum Verlassen. Die Bestrahlungszeit beträgt etwa drei Minuten. Man spürt nichts. Danach geht man nach Hause, so als wäre nichts gewesen.
Ein anderes Gerät, das wir verwenden, ist der Bestrahlungsroboter Cyberknife. Das ist ein Roboter. Es ist das Modell, das auch in den Schweißstraßen der Automobilindustrie als Schweißroboter benutzt wird. Oben hängt ein Linearbeschleuniger. Dieses Gerät kann feine Bewegungen des Therapiestrahls sehr schnell und präzise ausführen, weil der Roboter den Beschleuniger sehr schnell bewegen kann. Das Beste an diesem Gerät ist die Software. Sie kommt aus dem Institut für Robotik der Uni Lübeck. Diese Software kann Bewegungen des Patienten vorausberechnen. Sie erkennt Atembewegungen oder andere Bewegungen und berechnet voraus, was in den nächsten 200 Millisekunden passieren wird. Danach wird der Strahl ausgerichtet. Dadurch kann man bei bestimmten bewegten Organen, zum Beispiel der Lunge, extrem präzise bestrahlen, auch mit der Ungenauigkeit, selbst bei bewegten Organen von etwa 1,5 Millimetern.
Interview “Ein Großteil der Männer mit Prostatakrebs kann sich bestrahlen lassen”, sagt Prof. Jürgen Dunst. |  |
|---|
Wie wirkt Strahlung?
Das verstehen viele nicht. Selbst wenn man mit Kollegen spricht, sagen sie manchmal: „Mensch, brutzelt das doch mal weg." Das klingt so, als würde irgendetwas verbrannt. Das stimmt nicht. Wenn man eine Zelle betrachtet, dann hat die Zelle einen Zellkern, in dem sich verschiedene Bestandteile befinden. Der Zellkern ist in der Mitte der Zelle und in diesem befindet sich das Erbgut, die DNA. Die DNA ist das Wichtigste für die Funktion der Zelle.
An der DNA entstehen in jeder Sekunde Schäden. Diese werden permanent repariert. Unsere Zellen sind auf das Reparieren spezialisiert, vor allem die Zellen, die ein Leben lang arbeiten müssen und nicht ersetzt werden, zum Beispiel vom Herz und Gehirn. Wenn ein paar Herzzellen absterben, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, gibt es keinen Ersatz. Beim Schlaganfall im Gehirn auch nicht. Diese Zellen, die ein Leben lang arbeiten müssen, können DNA-Schäden wahnsinnig gut reparieren.
Kranke Zellen können das nicht so gut. Tumorzellen haben eine kranke DNA, sonst wären sie keine Tumorzellen. Krebs ist eine DNA-Erkrankung, die Reparaturmechanismen funktionieren nicht so gut. Das bedeutet: Man kann die Bestrahlung auf Zellen geben. Die gesunden Zellen können sich erholen und die kranken Zellen sterben ab. Nehmen Sie ein Organ, zum Beispiel die Prostata, und stellen Sie sich vor, dass die gesunden Zellen grün sind und innen im Organ ein paar böse Zellen rot sind. Wenn Sie nichts tun und der Tumor wächst, werden die roten Zellen mehr. Sie verdrängen die gesunden Zellen und zerstören das Organ.
Wenn Sie eine Strahlentherapie durchführen und es richtig gut funktioniert, passiert Folgendes: Nach einer gewissen Zeit sind die roten Zellen weg. Das kann bei Prostatakrebs ein Jahr oder länger dauern, bis alle roten Zellen verschwunden sind. Die grünen Zellen bleiben. Manchmal bilden sich sogar da, wo die grünen Zellen waren und die roten Zellen sie verdrängt hatten, wieder neue Zellen.
Es gibt eine Voraussetzung dafür, dass das zum Schluss wieder so gut aussieht: Man die Toleranzdosen der einzelnen Organe kennt. Wir müssen also wissen, welche Strahlendosis ein Organ verträgt. Diese Toleranzdosen hat man im Laufe der letzten 20 bis 30 Jahre sehr gut kennengelernt. Wir können sie bei jeder Bestrahlungsplanung berücksichtigen, sodass wir heutzutage in der Lage sind, mit sehr geringem Risiko zu bestrahlen.
Wenn Sie als Mann eine Behandlung wegen eines Prostatakarzinoms hinter sich haben, in eine Röntgenpraxis gehen und dort ein MRT machen lassen und dem Arzt nicht sagen, dass sie operiert worden sind, sieht er sofort, dass sie prostatektomiert sind. Denn: die Prostata fehlt. Aber er sieht nicht, dass sie bestrahlt worden sind, weil alles wie zuvor aussieht.
Fortschritte bei der Strahlentherapie
Die Bestrahlunghat im Lauf der letzten Jahre einen enormen Fortschritt gemacht. Das hat mich selbst sehr überrascht und ich hätte das vor 20 oder 30 Jahren nicht gedacht. Von ungefähr 1990 bis 2000 war die Operation ganz sicher das beste Verfahren. Die Bestrahlung war gefährlich und nicht so effektiv. Um das Jahr 2010 herum war die Bestrahlung so gut, dass sie an die Ergebnisse der Operation herangekommen ist, aber die Nebenwirkungen waren immer noch so wie bei einer Operation, vielleicht sogar ein bisschen schlechter.
In den letzten Jahren – ich werde Ihnen gleich ein paar Beispiele aus klinischen Studien zeigen – hat die Bestrahlung, was die Verträglichkeit angeht, die Operation überholt. Das Beste an der ganzen Sache ist, das dies noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. In den nächsten Jahren werden wir viele Entwicklungen haben, die die Bestrahlung verbessern werden, zum Beispiel die adaptive Bestrahlung mit dieser Künstlichen Intelligenz oder biologische Bestrahlungsplanung. Professor Lützen, mein Kollege aus der Nuklearmedizin, wird Ihnen nachher ein Verfahren vorstellen: PSMA PET-CT. Wir sind die Disziplin, die davon am meisten profitiert. Das bedeutet, bei den einfachen Fällen ist die Heilungsrate heutzutage fast 100 Prozent. Da geht es eigentlich nur noch darum, den Patientenkomfort zu verbessern.
Studien zur Bestrahlung
Wir werden eine Studie starten, wo wir in Zukunft – das wird in diesem Jahr noch der Fall sein – Patienten mit frühem Prostatakrebs nur noch dreimal behandeln. Drei ambulante Behandlungen an jeweils einem Nachmittag. Sie können um 12 Uhr kommen, um 13 Uhr gehen sie nach Hause, um 15 Uhr zum Skat-Abend und ihre Skat-Kumpel werden nicht merken, dass sie bei der Bestrahlung waren. Bei den fortgeschrittenen Fällen besteht noch erheblicher Verbesserungsbedarf. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben, die Ergebnisse der Bestrahlung zu verbessern.
Ich zeige ihnen drei Studien. Wir leben in der Zeit, wo häufiger irgendwas behauptet wird. Zum Beispiel gestern Abend im Fernsehen, Donald Trump. Jetzt machen wir mal einen Faktencheck, dass das, was ich gesagt habe, wirklich stimmt. Ich stelle Ihnen als erstes eine wichtige Studie vor, die Protect-Studie. Sie kommt aus Großbritannien und ist erst vor kurzem publiziert worden. Das Wichtigste an der Studie ist, dass die Patienten, die dort behandelt worden sind, bis zu 17 Jahre nachbeobachtet worden sind. Man kann als Arzt oder Patient über das britische Gesundheitswesen schimpfen bis zum geht nicht mehr. Da will keiner von uns arbeiten. Aber die Forschung in Großbritannien ist exzellent. In dieser Studie wurden 80.000 Patienten gescreent und zweieinhalbtausend, die Prostatakrebs hatten, wurden für die Studie sozusagen vorbereitet. 1.600 Patienten sind in dieser Studie behandelt worden, also ein relativ großer Anteil.
Jeweils ein Drittel unterzog sich einer aktiven Überwachung, ein Drittel einer Operation und ein Drittel der Bestrahlung. Nach 15 Jahren waren in jeder Gruppe nur zwei Prozent der Patienten an Prostatakrebs verstorben. Die Todesrate war in allen drei Armen gleich. Das ist ein Argument dafür, dass wir bei bestimmten Patienten eine aktive Überwachung gut empfehlen können. Allerdings musste ein Teil der Patienten mit einer aktiven Überwachung doch behandelt werden. Die Hälfte der Patienten, sogar ein bisschen mehr, unterzog sich einer Behandlung und es gab einen kleinen Nachteil im Auftreten von Metastasen. Eine sehr gute Studie. Das Problem ist, dass diese Studie ab 2000 durchgeführt wurde und die Therapieverfahren aus heutiger Sicht noch nicht das Modernste waren. Das betrifft besonders die Strahlentherapie.
In dieser Studie wurde auch untersucht, wie es den Patienten nach der Therapie geht. Zwei wichtige Aspekte sind herausgekommen: Das eine ist Harninkontinenz, also ein unkontrollierter Harnabgang. Da hat man sich angesehen, wie viele Männer eine Vorlage brauchen, also Tena für Men. Kennen Sie aus der Fernsehwerbung? Man sieht, dass Patienten, die bestrahlt worden sind, und Patienten, die zunächst keine Therapie erhalten hatten, ziemlich gleich sind.Die bestrahlten Patienten schneiden sogar ein bisschen besser ab, während bei den operierten Patienten der Anteil, die Vorlagen tragen, ein bisschen größer ist. Das gilt über den gesamten Zeitraum.
Der zweite Aspekt ist die Sexualfunktion. Bei Beginn der Studie ist sie natürlich nicht bei 100 Prozent. Es sind ja keine jungen Männer mehr. Man sieht aber, dass die Sexualfunktion nach der Operation fällt und auf einem guten Niveau bleibt. Aber die Bestrahlung ist besser. Die Ergebnisse sind so wie bein Patienten, die nicht behandelt worden sind. Im ersten Jahr lässt sich ein Knick und Abfall beobachten. Das hängt aber nicht mit der Bestrahlung zusammen, sondern damit, dass in dieser Studie alle Männer zur Unterstützung der Bestrahlung sechs Monate eine Antihormontherapie hielten, also eine chemische Kastration. Man sieht, dass der Kastrationseffekt etwa ein Jahr andauert. Danach hat er sich ausgeglichen. Die Studie zeigt jedoch, welchen Vorteil die Bestrahlung in diesen Punkten haben kann. In der zweite Studie kam übrigens genau das Gleiche heraus.
Die dritte Studie will ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie ist gerade erst veröffentlicht worden. Die Studie heißt Pace-A-Studie, kommt auch aus Großbritannien und ist deswegen interessant, weil sie die modernsten Therapieverfahren miteinander vergleicht - ob Operation mit dem Operationsroboter Da Vinci oder Bestrahlung mit dem Bestrahlungsroboter Cyberknife. Die Studie ist von meinem Kollegen Nicholas Van As aus dem Royal Marsden Hospital in London geleitet worden. Das Royal Marsden Hospital ist das relevanteste Krebskrankenhaus in Großbritannien. Prinzessin Kate ist vor kurzem dort behandelt worden.
Nicholas Van As, der oft auf Vorträgen in Europa unterwegs ist und diese Studie vorstellt, spicht von „The Battle of the Robots. Also: Welcher Roboter ist der Bessere? Wenn man eine solche Studie macht, muss man eine Hypothese formulieren: Was will man zeigen? Die Hypothese war: Wenn Patienten bestrahlt werden, dann haben sie etwas geringere Inkontinenzraten, als wenn sie operiert werden. Erwartet worden war, dass bestrahlte Patienten eine Inkontinenzrate von etwa vier Prozent haben. Also vier Prozent der Männer brauchen Tena Men. Das ist der Normalwert dieser Altersgruppe. Besser wird es nicht. Und erwartet wurde, dass es bei den operierten Patienten 15 Prozent sind. Herausgekommen ist, dass man diesen Wert bei der Bestrahlung ziemlich genau trifft. Bei der Operation ist der Wert dagegen sogar noch höher als erwartet. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass man zumindest unter diesem Aspekt die Bestrahlung als ein sehr schonendes Verfahren ansehen kann.
Man muss etwas Wasser in den Wein gießen, denn wir haben bisher nur Daten, was die Verträglichkeit angeht. Die Daten hinsichtlich der Heilungsraten, werden wir aus dieser Studie erst in drei, vier, fünf Jahren haben. Aber dass die Operation, was die Heilungsraten angeht, besser sein sollte als die Bestrahlung, ist unter Experten praktisch ausgeschlossen.
Weitere Formen der Strahlentherapie
Ein letzter Punkt, den ich Ihnen noch darstellen will, ist die Hochpräzisionsbestrahlung von Metastasen. Manchmal treten nach einer Behandlung irgendwo im Körper kleine Metastasen auf, die heutzutage mit PSMA-PET gut erkannt werden können. Es besteht die Möglichkeit, diese Metastasen mit wenigen hochpräzisen Bestrahlungen zu behandeln, hier mit dem Cyberknife. Das ist noch nicht so weitverbreitet gemacht worden, aber es geht auch mit anderen Geräten. Das sind fünf ambulante Bestrahlungen. Wenn man so ein kleines Gebiet bestrahlt, merkt man das gar nicht. Die Erfolgsquote an der Stelle, die man bestrahlt hat, ist ziemlich hoch - über 90 Prozent. Dieses Verfahren wird möglicherweise in Zukunft für Patienten mit nur wenigen Metastasen eine wichtige Verbesserung sein wird. Einzelne Studien zeigen: Wenn man bei Patienten alle sichtbaren Herde behandelt, verbessert dies den Langzeitverlauf der Erkrankung wesentlich und man drängt das Auftreten von weiteren Metastasen zurück.
Es gibt aber noch viel mehr zur Bestrahlung zu sagen, was ich aus Zeitgründen nicht konnte. Zum Beispiel habe ich die vielfältigen Möglichkeiten der Strahlentherapie von innnen, der Brachytherapie, nicht erläutert. WIchtig ist auch die Kombination von Bestrahlung und Antihormontherapie, Strahlentherapie nach Operation oder wenn der PSA-Wert nach der Operation steigt, die Strahlentherapie im fortgeschrittenen Tumor mit Lymphknotenfall. Da gibt es sehr gute Hinweise darauf, dass die Bestrahlung dort ein wirklich gutes Verfahren ist. Von der Strahlentherapie können auch Patienten profitieren, bei denen der Prostatakrebs metastasiert ist. Wahrscheinlich profitieren praktisch alle Patienten mit Metastasen von einer Strahlentherapie der Prostata. Nicht zuletzt gibt es auch die Möglichkeit der palliativen Bestrahlung bei Knochenschmerzen.
Wann welche Behandlung?
Eine aktive Überwachung kann man nur bei Patienten machen, die keine Risikofaktoren haben. Die radikale Prostatektomie hat ein sehr breites Spektrum und man kann sie bei fast allen Patienten einsetzen. Es gibt sehr interessante Bestrahlungsverfahren. Bei der Beratung zur Strahlentherapie spricht man über mehrere Verfahren und sucht das für Sie beste Verfahren aus. Beispiele:
- Die Brachytherapie eignet sich für Patienten, die eine harmlose Erkrankung haben.
- Die Bestrahlung mit Cyberknife oder anderen hochpräzisen Bestrahlungsgeräten eignen sich für Patienten, die lokalisierte Erkrankungen ohne große Risikofaktoren haben.
- Für alle anderen Fälle eignet sich die externe Bestrahlung von außen über die Haut, vielleicht in Kombination mit Brachytherapie und antihormoneller Therapie.
Sie sehen, dass das ein sehr breites Spektrum ist. Deswegen würde ich mich freuen, und das ist auch meine Empfehlung: Wenn Sie als Mann an einem Prostatakarzinom erkrankt sind, egal in welchem Krankheitsstadium: Suchen Sie den nächsten Facharzt für Strahlentherapie auf und lassen sich darüber beraten, ob für Sie Strahlentherapie eine Option sein könnte.
Nutzer-Fragen zur StrahlentherapieModerator: Herr Professor Dunst, wir haben im Vorfeld ein paar Patientenfragen bekommen, die online eingereicht worden sind. Eins, zwei davon würde ich auch gerne vorlesen. Eine Frage, die wir vorhin schon ähnlich hatten, als es um KI ging. KI und Bestrahlung, so heißt es hier wieder. Wie viel besser ist die KI-gestützte Bestrahlungstherapie des Prostatakarzinoms? Wie gehen Sie mit KI und der Bestrahlung um? Wie weit ist man aus Ihrer Sicht da tatsächlich? Prof. Dr. Jürgen Dunst: Diese KI-basierte Bestrahlung gibt es seit drei Jahren. Wir gehören zu den ersten Krankenhäusern hier im Norden, die ein solches Gerät haben. Das wird im Laufe der nächsten Jahre mehr werden. Wir haben im Moment noch nicht ausreichend Erfahrung damit. Wir wissen, dass das ungewöhnlich gut funktioniert. Jeder, der mit einem solchen Gerät arbeitet, ist fasziniert. Aber um die Frage zu beantworten: Was bringt das so richtig? Dafür müssten wir mit dieser Methode fünf, sechs, sieben Jahre Erfahrung haben. Wenn Sie mir die Frage in fünf Jahren stellen, kann ich sie beantworten. Moderator: Da sind Sie im wohlverdienten Ruhestand. Prof. Dr. Jürgen Dunst: Ja, könnte sein. Moderator: Aber okay, man muss sagen, für den Bereich KI muss man noch Geduld haben. Prof. Dr. Jürgen Dunst: Da muss man Geduld haben. Wir wissen es auch nicht, alle Verfahren entwickeln sich schnell weiter. Es gibt so viele Anwendungen, KI ist bei uns bei der Gerätesteuerung wichtig. Ein wichtiger Punkt wird aber auch sein, viele Therapievorschläge zu bekommen, und dass alle Informationen eines Patienten zusammengeführt werden. Das gibt es in anderen Bereichen schon, dass man einen Vorschlag bekommt- Man sagt: Dieser Experte in New York, wie würde er diese Erkrankung behandeln? Dann macht das Gerät einen Vorschlag und sagt: Eer würde es so machen. Das sind tolle Entwicklungen, mit denen wir im Laufe der nächsten Jahre die Qualität der Behandlung flächendeckend verbessern können. Moderator: Eine weitere Frage, verbunden, glaube ich, auch mit viel Hoffnung. Da heißt es: Besteht nach der Bestrahlung noch die Gefahr, dass sich andere Krebsarten quasi als Nachfolger, Darmkrebs, Knochenkrebs und so weiter entwickeln können? Prof. Dr. Jürgen Dunst: Theoretisch ja. Krebsstrahlentherapie ist so wie Chemotherapie eine Methode, die an der DNA etwas verändert und deswegen auch Krebs entstehen lassen kann. Wir wissen, dass Patienten, die in den 70er und 80er Jahren behandelt worden sind, in den nächsten Jahren ein leicht erhöhtes Krebsrisiko hatten. Das ist für Patienten, die nach 1995 behandelt worden sind, nicht mehr so eindeutig nachgewiesen. Man muss lange Nachbeobachtungszeiten haben, weil es oft erst nach 10 oder 15 Jahren auftritt. Die beste Studie bei Prostatakrebs ist die Protect-Studie, die ich erwähnt habe. Wir wissen aus dieser Protect-Studie nicht, wie viele Männer einen anderen Krebs als Prostatakrebs bekommen haben, aber wir wissen, wie viele Männer an einem anderen Krebs gestorben sind. Die Zahl bei den bestrahlten Patienten und bei den bei operierten Patienten ist exakt gleich, bei den bestrahlten sogar einen Tick niedriger. Das heißt, wir gehen im Moment davon aus, dass dieses Risiko für dieses Patientenkollektiv – sind ja keine jungen Männer mehr, das dauert ja 20, 30 Jahre –, dass dieses Risiko der Krebsentstehung durch Bestrahlung für die tägliche Entscheidungsfindung vernachlässigbar ist. |