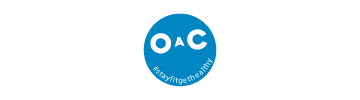Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Wie kann Nuklearmedizin bei Metastasen helfen?
10. Oktober 2025 | von Redaktion Prostata Hilfe DeutschlandKann die Nuklearmedizin bei der Therapie von Prostatakrebs helfen? Wie sieht es aus, wenn der Krebs bereits Metastasen gebildet hat? Wie schneiden nuklearmedizinische Verfahren im Vergleich ab? Und zahlt die gesetzliche Krankenkasse? Diese Fragen beantwortet der Nuklearmediziner Prof. Dr. Ulf Lützen.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden.
Wenn Sie dieses Modul sehen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an.
Prof. Dr. Ulf Lützen: Viele wissen vielleicht nicht, was die Nuklearmedizin macht. Deswegen würde ich damit beginnen, Ihnen zu erklären, wofür sie da ist. Die Nuklearmedizin macht molekulare Diagnostik und Therapie mit Hilfe von radioaktiven Medikamenten. Im Gegensatz zur Radiologie, die anatomische Schnittbildaufnahme mit Hilfe des CTs, MRTs oder Ultraschall macht, wollen wir mit Hilfe von radioaktiven Stoffen eine Ebene tiefer schauen und bestimmte Stoffwechselvorgänge sichtbar machen.
Wir wollen diese Prozesse nicht nur qualitativ beschreiben, sondern vielleicht auch quantitativ messbar machen. Einerseits möchten wir mit der Nuklearmedizin eine Art Ausbreitungsdiagnostik sicherstellen und erkennen, in welchem Stadium sich die Erkrankung unserer Patienten befindet. Andererseits wollen wir vielleicht mit anderen strahlenden Medikamenten auch Tumorerkrankungen behandeln. Wir versuchen also, die Strahlung zu nutzen, indem wir die radioaktiven Medikamente direkt an den Ort des Tumors bringen und ihn von innen behandeln.
Wir haben in den anderen Vorträgen schon viel zur Häufigkeit der Erkrankungen und zu unterschiedlichen Verfahren gehört. Mehrmals habe ich die Leitlinie eingeblendet gesehen. Wir haben etwas über Stadien und Prognosen, zu wichtigen Markern wie dem PSA-Wert und auch zu den Therapien gehört. Da stellt sich die Frage: Was kann die Nuklearmedizin zu dem Thema beitragen? Und Sie ahnen die Antwort: Natürlich ist das viel, und zwar sehr viel besser. Wir wollen mit unserem Fach, das wirklich sehr innovativ ist, sehr viel beitragen zur Diagnostik und Therapie.
Wir haben viele Innovationen. Das gilt nicht nur für die Onkologie und somit auch für Krebserkrankungen wie das Prostatakarzinom. Auch bei neurodegenerativen Erkrankungen wie den Demenzen kann die Nuklearmedizin sehr viel beitragen. Weil wir auf molekularer Ebene sehen, wie bestimmte Prozesse funktionieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die Nuklearmedizin im Bereich Prostatakrebserkrankungen in den letzten zehn Jahren die meisten Beiträge leisten konnte. Wir konnten sehr viel zur Diagnostik beitragen. Das Wichtige ist, dass wir das nicht nur einführen , sondern auch evidenzbasiert etablieren konnten. Das heißt, diese Verfahren sind wissenschaftlich belegt, sodass sie den Patienten in der Phase der Diagnostik, aber auch der Therapie nutzen können.
PSMA und Theranostik
Es gibt zwei wichtige Begriffe, auf die ich in den nächsten Minuten eingehen möchte. Das ist zum der Begriff PSMA und zum anderen die Theranostik. Das letzte ist ein Kofferwort, wie ich gelernt habe. Es setzt sich aus zwei Begriffen zusammen: Aus Therapie und Diagnostik. Über das PSMA möchten wir die Therapie adressieren.
PSMA ist das prostataspezifische Membranantigen. PSMA ist aber nicht zu verwechseln mit PSA - diesem Wert, den sie alle kennen. Theranostik bedeutet, dass wir unter der Nutzung der Zielstruktur PSMA auf der einen Seite Diagnostik machen und sehen, wo im Körper sich Tumorzellen befinden. Sind die Zellen nur auf den Ort begrenzt, wo der Tumor gewachsen ist, also im Organ selbst? Oder gibt es Absiedelungen auf dem Lymphweg oder auf dem Blutweg, sogenannte Metastasen?
Am Ende stellt sich die Frage: Können wir nicht mit derselben Zielstruktur dem Patienten auch eine Therapie anbieten? Das ist in der Regel in einem fortgeschrittenen Tumorstadium der Fall, wo wir mithilfe eines anderen strahlenden Agens arbeiten – sie kennen unterschiedliche Strahlungsarten vielleicht noch aus der Schule, zum Beispiel Alpha, Beta und Gamma. Das sind diese Radioaktivitätsstrahlungen, die wir kennen. Wenn wir die geschickt an diese Trägersubstanz koppeln, dann können wir diese Zielstruktur adressieren und angreifen.
In eine Zellmembran ist eine Proteinstruktur eingebaut. Diese Struktur hat man in den letzten Jahren entdeckt und sie hat bestimmte Aufgaben. Sie sorgt dafür, dass bestimmte Stoffe von außen in die Zelle hinein transportiert werden. Wir haben auch eine Enzymaktivität, die für uns aber gar nicht so relevant ist. Für uns ist interessant, dass wir diese Struktur nachweisen können und als Zielstruktur verwenden können. Wie machen wir das?
Sehen wir uns ein Zellmodell an, zum Beispiel eine Prostatakrebszelle. Die Zellmembran ist außen herum und in der Mitte befindet sich der Zellkern. Das Besondere ist, dass auf der Zelloberfläche dieser Prostatakarzinomzellen das PSMA überexprimiert wird. Das bedeutet: PSMA ist auf Tumorzellen viel häufiger vorhanden als auf einer gesunden Prostatazelle oder auf anderen Geweben im Körper. Wir haben einen Liganden, der das Gegenstück ist. Wie ein Sicherheitsschlüssel passt er in ein Sicherheitsschloss - in diesem Fall in das PSMA an der Zelle. Dieses Molekül - ein Pre-Cursor, eine funktionelle und nichtstrahlende Substanz, markieren wir mit Hilfe eines radioaktiven Liganden.
Diese Radioaktivität ist ein bisschen zu vergleichen mit einem GPS-Sender, den sie verfolgen können. Wir spritzen das Medikament über die Vene in die Blutbahn. Es verteilt sich mit dem Blutstrom und braucht ungefähr 30 Minuten, um sich alle Zellen im Körper anzugucken und nach dieser Zielstruktur zu suchen. Wenn das Medikament dort angekommen, dann dockt es sich dort an. Wir können den Verbleib hinterher in einem entsprechenden Gerät - einem Scanner - messen.
Wir verwenden ein Diagnostikum, in diesem Fall das strahlende Agens. Das hat nur wenige Minuten Halbwertzeit, was natürlich wünschenswert ist. Denn wir wollen erst einmal nur sehen, wo überall Tumorzellen sind. Der Patient soll danach möglichst rasch aufhören zu strahlen. Wenn das Bild im Kasten ist, wäre es gut, wenn der Stoff möglichst bald verschwunden ist. Deswegen liegen wir hier im Bereich von Minuten. Das klingt alles einfach, ist aber enorm logistisch aufwendig. Das können sie sich vorstellen, da der Stoff nur ein paar Minuten Halbwertszeit hat.
Wir haben in Kiel die einzige Radiopharmazie in ganz Schleswig-Holstein. Wir können hier radioaktive Substanzen für die Anwendung am Patienten selbst herstellen. Erfreulicherweise hat sich in den letzten Jahren auch die Möglichkeit ergeben, diese Stoffe zu kaufen, sodass auch andere Zentren sie verwenden können. Die radioaktiven Substanzen werden immer individuell für den Tag der Untersuchung hergestellt. Sie können diese Stoffe nicht auf Halde produzieren, in den Schrank legen und dann sagen: „Jetzt kommt ein Patient und ich nehme die mal heraus." Denn: Sie sind nach ein paar Stunden verschwunden. Jeder Patient, der angemeldet wird, muss den Stoff für diesen Tag hergestellt bekommen. Das muss unter Reinstraumbedingungen stattfinden. Wir spritzen nachher etwas in den Menschen hinein, das können wir nicht einfach so auf dem Tisch zurechtmischen.
Schließlich geht der Patient in den Scanner, in ein PET-CT-Gerät, bei dem wir eine CT-Komponente mit dem PET-Scanner kombinieren. Das heißt, es ist ein sogenanntes Hybridgerät. Es ermöglicht es uns , funktionelle Bildgebung - also molekulare Bildgebung - und CT-Bildgebung in einem Untersuchungsschritt zu machen. Die CT-Bilder, die Sie alle vielleicht kennen, werden an den spannenden Stellen farblich eingefärbt. Auf diese Weise kann man das besonders gut visualisieren und messen. Das ist gerade für Verlaufsbeurteilung unter einer Therapie interessant, um zu sehen, der Krebs ist zwar noch da, aber es ist weniger geworden. Das sind wichtige Aspekte.
Ein kurzer Ausflug zur Leitlinie, von der Sie heute schon mehrfach gehört haben. Darin steht, wie hoch die Wertigkeit dieses Verfahrens im Vergleich zur herkömmlichen Diagnostik ist. Man hat gesehen, vor allem bei australischen Arbeitsgruppen, dass man damit viel höhere Entdeckungsraten hat. In der Hochrisiko-Situation, zum Beispiel bei Patienten mit einer gefährlicheren Prostatakrebserkrankung , konnte man in 30 Prozent und auf diese Weise über 90 Prozent Sicherheit erlangen. Die Spezifität oder Sensitivität auf der anderen Seite - das heißt, dass man wirklich etwas detektieren kann - liegt deutlich höher in der PET-CT im Vergleich zur alleinigen CT-Bildgebung. Die Spezifität ist bei beiden relativ hoch.
Die Frage ist: Bei welchem PSA-Wert kann man dieses Verfahren anwenden, um zu hoffen, dass man die Veränderung, nach der man mit dem bildgebenden Verfahren sucht, auch im Körper nachweisen kann. Welcher PSA-Wert ist dafür günstig? Selbst bei niedrigen Werten kann das PSMA-PET-CT das untersuchen. Die früheren Untersuchungen mit Cholin-PET, die vielleicht einige von Ihnen noch kennen, waren deutlich schlechter. Da musste der PSA-Wert schon viel, viel höher sein, um überhaupt den Ort zu finden, der dafür verantwortlich war, dass dieser Wert im Blut messbar war.
Eine interessante Aussage, die in einer wissenschaftlichen Arbeit belegt worden ist, ist diese Tatsache: Durch die Informationen, die man aus dem PET-CT gewonnen hat, verändert man in 50 Prozent der Fälle das Vorgehen gegenüber der Planung und Einschätzung des Patienten, wenn alle Bilder gemacht worden sind.
Wie läuft die Untersuchung ab?
Nach der Synthese und Gewinnung des Nuklids, also der Herstellung des Radiopharmakons, wird das in die Vene injiziert. Es verteilt sich mit dem Blutstrom. Nach 30 Minuten sind alle Zellen sozusagen bedeckt und das radioaktive Mittel hat sich verteilt. Wichtig ist, dass die überflüssige Strahlung, die nicht zur Bildgebung beiträgt, den Körper wieder über die Nieren verlässt. Deswegen wartet man insgesamt 60 Minuten.
Dann wird der Patient in den Scanner gelegt. Dort wird die Messung durchgeführt. Wir messen also die Emissionen, die aus dem Patienten durch die Strahlung herausfliegen, um das Bild zu generieren. Das dauert bei unseren technischen Möglichkeiten heute ungefähr 25 Minuten, vom Scheitel bis zu den Oberschenkeln, um die Verteilung des Nuklids zu messen. Manchmal brauchen wir für besonders spannende Körperabschnitte noch sogenannte Spätaufnahmen, für die wir die Ausscheidung des Stoffes durch eine Medikamentengabe beschleunigen.
Wichtig für Sie ist zu wissen: Ist das besonders viel Strahlung? Geht mit einer solchen Untersuchung sehr viel mehr Strahlung einher als zum Beispiel mit einer CT-Untersuchung, zum Beispiel vom Brustkorb und Bauraum? Die Menge der Strahlung ist ungefähr vergleichbar. Die Menge der Radioaktivität plus ein sogenanntes Low-Dose-CT mit möglichst wenig Strahlung hat am Ende so ungefähr 6 bis 8 Millisievert, was ungefähr der gleichen Menge an Strahlung entspricht, die man für eine diagnostische CT-Untersuchung braucht.
Ich will Ihnen ein Beispiel zeigen von einem Patienten, der operiert worden war, der einen PSA-Abfall hatte - wie zu erwarten nach der Operation, erfreulich bis zur Nachweisgrenze. Aber irgendwann ist leider der Zeitpunkt gekommen, an dem der PSA-Wert wieder angestiegen ist. Da ist die entscheidende Frage: Wo ist der Ort im Körper und die Manifestation, an dem dieser PSA-Wert sich festmachen lässt, wo dieses gebildet wird?
Das ist ein solches Bild, ein ausgewählter Ausschnitt aus dem Bauchraum. Das ist die Verteilung des Nuklids im Bauchraum. Sie sehen, dass es physiologischerweise die Aufnahme dieses radioaktiven Stoffes in der Niere gibt, die das ausschaltet. Sie sehen ein bisschen die Oberbauch-Organe, ein bisschen im Darm. Hier ist die Harnblase, die es aus den Nieren herunterleitet. Aber dieser Punkt, der war auffällig. Das ist ein sehr, sehr niedriger PSA-Wert von 0,2 Nanogramm pro Milliliter. Was wir jetzt haben, ist zusätzlich zu der eigentlichen Verteilung des Prostataspezifischen Membranantigens die hybride Bildgebung durch die CT-Komponente. Hier sehen sie: An dieser Stelle ist ein ganz, ganz kleiner Lymphknoten, der allein durch die Diagnostik im CT sicher nicht als suspekt oder malignom-typisch, also bösartig typisch, klassifiziert werden kann. Aber wir können in der Zusammenschau beider Informationen aus diesem komplementären, bildgebenden Verfahren sagen: „Ja, das ist der einzige Ort, an dem diese PSMA-Positivität nachweisbar ist, auch wenn der Lymphknoten per se noch recht klein ist. Das bedeutet, es ist ein lokales Problem, das man auch lokal behandeln kann. So ist es bei diesem Patienten auch gemacht worden.
Herr Prof. Dunst hatte vorhin sehr schön ein Bild von seinem Studenten-Unterricht gezeigt, und zwar das ähnliche Bild. Er hatte gesagt, wichtig ist, und dazu trägt genau dieses bildgebende Verfahren ganz besonders bei, zu entscheiden, in welchem Stadium hinsichtlich der Ausbreitung sich die Erkrankung befindet.
Beim Prostatakarzinom kann das in der Prostata selbst sein oder es kann durch die Streuung auf dem Blut- oder auf dem Lymphweg leider an vielen Stellen sein. Vielleicht gibt es auch etwas dazwischen. Wenn wir eine Ausbreitung haben, die sich ganz lokal begrenzt zeigt, kommen natürlich die lokalen Therapieverfahren wie Chirurgie und Strahlentherapie infrage. Wenn ich ein systemisches Problem habe, müsste die medikamentöse Therapie infrage kommen, weil ich versuche, durch meine Therapie alle Zellen zu treffen. Dazwischen gibt es dieses Stadium, von dem sie vielleicht schon gehört haben, das sogenannte Stadium der Oligometastasierung. Dabei gibt es wenige einzelne Krebsabsiedelungen, bei dem man vielleicht noch so eine Art Heilungsansatz haben kann. Hier versuche ich, den Krebs möglichst noch zu heilen. Sonst ist es im Grunde eine palliative Situation. Trotzdem kann man da sehr viel machen. Herr Dunst hatte vorhin schon ein ähnliches Bild gezeigt von einem Lymphknoten. Da hat er freundlicherweise Bilder von uns verwendet. Das ist ein Bild, wo wir eine Knochenmetastase haben. Wenn wir uns orientieren, sind wir hier im Bereich der Beckenregion und Sie sehen hier am unteren Schambeinast auf der linken Seite eine Knochenmetastasierung, eine schmerzhafte Knochenmetastasierung.
Dieses PET-CT diagnostiziert das durch die erhöhte PSMA-Expression. Dann hat Herr Dunst das zielgenau bestrahlt. Er hatte vorhin auch schon gesagt, hoch, mit hoher Einzeldosis, aber insgesamt nur eine ganz kurze Bestrahlungsdauer. Am Ende können sie das Ergebnis hier sehen. Wir haben nach einigen Wochen die PSMA-PET-CT-Untersuchung wiederholt und sie sehen, dass es an der Stelle, wo es vorher geleuchtet hat, nichts mehr zu sehen war hinsichtlich der PSMA-Expression. Das heißt, der Tumor war vollständig ausgeschaltet worden. Wir sehen nur noch leichte Veränderungen des Aussehens in der CT, die typisch sind für die Veränderung nach einer entsprechenden Behandlung. Man hat damit eine sehr hohe Tumorkontrolle und auch ein sehr gutes Werkzeug, um das Ansprechen der Behandlung zu überprüfen. Ein Bild kann aber auch so aussehen, ein PSMA-Bild. Das Bild habe ich gemacht bei einem Patienten, von dem ich wusste, dass der PSA-Wert über 700 war. Ich wusste aus den vorherigen Untersuchungen, dass es viele, viele Knochen-und Lymphknotenmetastasen gab. Er hatte alle möglichen Therapieoptionen hinter sich, medikamentös, Chemotherapie, und trotzdem war der Tumor immer nach einer gewissen Wirkdauer resistent geworden und ist weitergewachsen.
Das ist die Frage: Warum machen wir dieses Bild? Ich will das kurz zurückstellen. Und noch einmal kurz dazu kommen: Was sind denn die Indikationen jetzt genau? Was sagen die Leitlinien? Welche Patienten sollen eine PSMA-PET CT bekommen? Da gibt es drei wichtige Punkte. Der erste ist der Patient in der Hochrisikosituation, der einen hohen Gleason-Score hat, der ein hohes lokales Tumor-Stadium hat und der einen hohen PSMA-Initial hat. Er sollte sich aufgrund des Risikos der Metastasierung frühzeitig zu einer PSMA-PET-CT-Untersuchung zur Ausbreitungsdiagnostik einfinden, damit man sagen kann, wo überall im Körper möglicherweise Absiedelungen des Tumors sind. Das klassische Anwendungsgebiet ist die sogenannte Rezidiv-Diagnostik, so wie Sie es hier sehen. Da gibt es den Patienten, der operiert wurde und den, der bestrahlt wurde. Da gibt es bestimmte Grenzwerte für die PSA-Werte, die sie dort sehen. Wenn die überschritten werden, sollte man schauen, wo möglicherweise eine Zelle ist oder wo etwas übrig geblieben oder wiedergekommen ist.
Als letztes geht es um die Überprüfung der Therapieoption. Wenn wir ein fortgeschrittenes Tumorstadium haben, stellt sich die Frage: Was können wir dem Patienten therapeutisch noch anbieten? Da kommt die PSMA-Therapie, die sogenannte Peptid-Radioligandentherapie mit Lutetium-PSMA ins Gespräch.
Therapie und Kostenübernahme
Ganz kurz noch zur Kostenübernahme, weil wir sehr häufig gefragt werden: Bekomme ich als Kassenpatient eine solche Leistung - ja oder nein?
Früher war es so: Für privatversicherte Patienten war es kein Problem. Gesetzlich Versicherte mussten in der Vergangenheit sehr aufwendig individuelle Kostenübernahmeanträge bei ihrer Kasse stellen oder haben die Leistung am Ende selbst bezahlt. Zum Glück haben wir heute die Ambulante Spezialärztliche Versorgung, die sogenannte ASV-Regelung. Diese ist aber ist leider nicht überall in Deutschland gegeben.
Wir haben hier in Kiel glücklicherweise die Möglichkeit, über diese ambulante Spezialärzteversorgung auch unsere gesetzlich versicherten Patienten mit so einer Leistung zu versorgen. Wir werden immer wieder gefragt, wie funktioniert das? Wir werden gerade von Ärzten und Kollegen und Patienten gefragt: Ist mein Arzt Teil dieser Versorgungsstruktur? Ich will kurz erklären, wie das funktioniert. Wenn ihr Arzt nicht selbst Teil des Kernteams ist, muss er Sie oder den Patienten an ein Kernteammitglied überweisen. Das kann der Urologe sein. Onkologen, überhaupt Krebsärzte, können den Patienten erst einmal sichten. Sie müssen die Indikation stellen, den Patienten einem Tumor-Board vorstellen und dann wird gesagt: „Ja, dieser Patient, der würde von einer solchen PSMA-PET CT-Untersuchung profitieren."
Dann würde dieser Patient an die ASV-eigene Nuklearmedizin – das wäre in diesem Fall wir – weitergeleitet. Wir machen die Untersuchung, erstellen einen Befund, geben den Befund an den ASV-Zuweiser und der gibt den Patienten weiter an seinen Arzt oder leitet selbst schon eine entsprechende Therapie ein. Also sehr gut geregelt. Man möchte diese Erkrankung von Spezialisten betreut wissen.
Wir kommen zu unserem Bild von gerade eben zurück. Sie erinnern sich an diesen Patienten: ausgedehnt, polytob bis disseminiert (Anmerk. d. Red: gestreut), überall PSMA-positive Metastasen. Auch dazu hat die Leitlinie etwas festgehalten: Wenn alle Therapieoptionen medikamentös, antihormonell, Chemotherapie, ausgereizt sind, was können wir dem Patienten noch anbieten? Da kommt jetzt die Lutetium-PSMA-Therapie in Betracht. Sie erinnern sich auch an dieses Schaubild von vorhin. Das war das Bild für die Diagnostik. Was machen wir jetzt? Wir ersetzen das Nuklid einfach, dieses strahlende Element von einem Diagnostik-Strahler zu einem Therapie-Strahler. Dieser Therapie-Strahler, in diesem Fall das Lutetium 177, hat eine sehr viel längere Halbwertzeit. Das heißt, wenn ich eine Substanz habe, die auf eine Tumorzelle einwirken will, dann soll sie das lange machen. Nicht ein paar Minuten und wieder verschwinden, sondern einige Tage da sein und auf die Zelle einstrahlen, mit einer möglichst hohen Energie, aber einer kurzen Reichweite.
Das heißt, wenn das schon hier oben an der Zelle wirklich festmacht und auch in die Zelle hineingezogen wird, brauche ich eine Reichweite von wenigen Millimetern. So ist es hier auch: 1,5 Millimeter, eine Bestrahlung von innen. Alle wichtigen umgebenden, gesunden Strukturen werden dadurch geschont und der Transit, bis der Stoff an der Zelle angekommen ist, dauert genauso lange wie bei der Diagnostik, ungefähr 30 Minuten. Das heißt, wir haben wenig Kollateralschäden, eine hohe lokale Tumorkontrolle. Das ist das, was wir haben wollen. Früher mussten wir das im Rahmen eines individuellen Heilversuches machen. Das Medikament war noch nicht zugelassen und wir konnten das selbst bei uns in unserer Radiopharmazie herstellen. Das war sehr erfreulich. Inzwischen gab es eine wichtige Studie. Wir haben vorhin schon mal das New England Journal of Medicine gesehen. Wichtige Studien werden immer in diesem wichtigen Journal veröffentlicht. Das war die sogenannte Vision Studie.
Was wurde gemacht in diesem Vision Trial? Was stand in der Studie? Das Ergebnis von ungefähr über 800 Patienten, die eingeschlossen worden waren, sie hatten das damals typische Therapieregime bekommen. Eine Gruppe wurde per Zufall dieser Studie zugelost. Ein Patient hat das Standardverfahren bekommen und zwei andere haben das Standardverfahren plus diese PSMA-Therapie bekommen. Es konnte gezeigt werden, nachdem es wie eine Art Chemotherapie in Zyklen appliziert worden war, dass man einerseits eine besonders gute Wirksamkeit hatte hinsichtlich der eigentlichen palliativen Idee der Verbesserung der Probleme, die diese metastasierte Erkrankung bringt– bei Knochenmetastasen sind das häufig Knochenschmerzen –, dass diese verbessert werden konnten. Zusätzlich konnte das Gesamtüberleben bei dieser fortgeschrittenen Tumorerkrankung erzielt werden. Das alles bei einer sehr guten Verträglichkeit. Das heißt, wir hatten kaum höhergradige Nebenwirkungen. Das ist sehr erfreulich, wenn eine Therapie gut vertragen wird und auch noch wirkt. Das war im Grunde so ein großer Beleg dafür, als Evidenz zu sagen: Ja, wir lassen dieses Medikament wirklich zu und können es auf diese Weise heutzutage kaufen.
Welche sind die Indikationen für die PSMA-Therapie? Fortgeschrittene Erkrankung, also kastrationsresistent und metastasiert, nicht mehr operabel. Dann mussten die bisherigen Leitlinien-konformen Therapien alle erfolgt sein. Am Ende hat sich dann, wie gesagt, leider die Resistenz gezeigt gegenüber all diesen Sachen. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten. Dann musste das PSMA-PET zeigen, dass der Stoff wirklich dort speichert. Wenn Sie einen negativen PSA-Scan haben, dann können Sie die Therapie nicht machen, weil das Ziel nicht adressiert werden kann.
Zudem ist es wichtig, dass man eine ausreichende Nierenfunktion hat. Sie haben gesehen, der Stoff wird über die Nieren ausgeschieden. Da muss man sicher sehen, dass man da keine Einschränkung hat. Und sie brauchen ausreichend Blutzellen, die im Knochenmarkt gebildet werden. Thrombozyten, also Blutplättchen, und weiße Blutkörperchen sind da besonders wichtig. Die letzte Chemotherapie sollte mindestens ein halbes Jahr her sein. Das läuft, wie gesagt, in Zyklen ab. Die Patienten kommen alle 6 bis 8 Wochen stationär für einige Tage zu uns und erhalten diese Therapie, die sogenannte Atomspritze. Tatsächlich kriegen Sie die Spritze einmal – hier sehen Sie einige Impressionen von unserer Station, das sieht relativ modern aus bei uns im UKSH in Kiel. Die Zimmer sind mit ein paar Accessoires ausgestattet, die vor allem dem Strahlenschutz dienen, damit die Mitarbeiter von uns, die jeden Tag diese Patienten betreuen, einen gewissen Schutz haben vor der Strahlung. Dem Patienten nützt die Strahlung. Deswegen spricht man da von der sogenannten rechtfertigen Indikation. Unsere Mitarbeiter müssen geschützt werden, aber sie laufen ganz normal herum. Da kommt jeden Tag jemand zur Visite, bringt ihnen etwas zu essen und trinken. Sie werden nicht allein gelassen. sondern es ist ganz normal, wie auf einer normalen Station.
Dann gibt es, wie gesagt, einmal während dieses Aufenthaltes, diese Spritze. Es ist nicht so, dass man jeden Tag eine Spritze bekommt, sondern einmalig. Danach wird jeden Tag geschaut, dass ihre Ausscheidungen aufgefangen werden, in der sogenannten Abklinganlage. Das heißt, sie gehen ganz normal auf Toilette, aber die Abwässer werden bei uns gesammelt. Und wir machen jeden Tag Aufnahmen. Das heißt, dieses Nuklid hat nicht nur diese kurzreichende Beta-Minus-Komponente, sondern noch eine Gamma-Komponente. Sie können den Verbleib Ihres Therapeutikums sichtbar machen. Ich glaube, viele Onkologen beneiden uns darum, dass wir sehen können, wo unser Medikament abgeblieben ist. Wir machen also Bilder und hier sehen Sie noch mal den idealen Verlauf.
Das sind tatsächlich Bilder eines Patienten, den ich behandelt habe. Das ist sein Bild vorher. Ganz viele Stellen, in denen sich Metastasen manifestiert hatten. Das Bild, das nächste, das sich drehen sollte, zeigt den Patienten nach zwei Zyklen dieser PSMA-Therapie.
Vorher enorm hoher PSA-Wert, am Ende alles weg. Kein PSA-Wert mehr, keine einzige Metastase mehr. Das sind super erfreuliche Verläufe, die wirklich nur in ein bis 3 Prozent der Fälle in der Literatur beschrieben werden.
Das ist der häufigere Fall, aber auch ein gutes Ergebnis im Sinne der Palliation. Der Patient, den wir vorhin gesehen hatten, hatte sechs Zyklen bekommen. Sie sehen hier die Therapiebilder. Wir haben unser Nuklid genommen mit Hilfe der Gamma-Kamera, qualitativ ein bisschen schlechter, aber sie können deutlich sehen, ob die Organe, die sie treffen wollten, die Manifestationen von Metastasen, getroffen worden sind. Und sie können auch dosimetrisch messen, wie viel die Nieren zum Beispiel abbekommen haben, um Kollateralschäden abzuschätzen. Am Ende sehen sie das Bild nach sechs Zyklen. Sie sehen viel weniger Herde, die Intensität ist viel geringer geworden. Der PSA-Wert war von über 700 auf unter 10 gefallen. Aber das ist gar nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass der Patient vorher immobil war aufgrund der Schmerzen, die die Knochenmetastasen verursacht hatten. Er konnte wieder herumlaufen und für ihn war wichtig, mit seinen Kegelbrüdern zu kegeln. Das konnte er wieder machen und deswegen hat er viel Lebensqualität gewonnen. Es ist aber eine palliativmedizinische Maßnahme für eine fortgeschrittene Tumorerkrankung. Das muss man festhalten.
Wir selbst haben unsere Ergebnisse ausgewertet, um zu sehen, ob wir die gleichen Ergebnisse wie andere Einrichtungenhaben. Erfreulicherweise konnten wir bei unseren Patienten durchschnittlich das Überleben um ein Jahr verlängern. Eine gut verträgliche Therapie verlängert das Leben. Normalerweise sind Palliativmethoden oder Maßnahmen nur dazu da, die Lebensqualität zu verbessern. Wir haben zusätzlich diese Verlängerung des Lebens. Wir konnten auch prognostische Faktoren herausarbeiten. Es gibt bestimmte Marker, vielleicht schon im Blut, also Blutwerte, die einem sagen können, ob die Patienten von der Therapie profitieren oder nicht. Hier sind einige ungünstige Faktoren aufgefallen. Zum Beispiel führt eine Lebermetastasierung dazu, dass der Outcome für die Patienten am Ende nicht so gut ist. Ein hoher LDH-Wert, also Laktatehydrogenase, ein Laborparameter der Ausdruck der Tumorlast ist, zeigt, wenn er sehr hoch ist, dass es nicht so günstig ist, ebenso wie ein niedriger roter Blutfarbstoffwert, also das Hämoglobin.
Auf der anderen Seite ist die Lebensqualität ganz entscheidend. Die Daten konnten wir auf einem europäischen Kongress publizieren. Wir sehen, dass mit jeder Gabe dieses Radionuklids, wenn wir das in Zyklen geben, die Lebensqualität der Patienten, die mit standardisierten Fragebögen befragt worden sind, steigt. Das heißt, sie fühlen sich besser. Sie haben auch mehr Hoffnung. Es erreicht so eine leichte Plateauphase, aber wir sehen insgesamt einen Anstieg der Lebensqualität der behandelten Patienten.
Am Ende möchte ich einen Ausblick in die Zukunft geben. Natürlich ärgern uns ein paar Dinge, vor allem die lange Wartezeit der Patienten auf entsprechende Untersuchungstermine. Da kann sicher die Technologie und die Entwicklung der Scanner ein bisschen zu beitragen, dass wir eine Beschleunigung hinbekommen. Im Moment scannen wir mit einer Scan-Länge von diesem PET-CT von ungefähr 20, 25 Zentimetern. Das heißt, der Patient muss durch diesen Ring gefahren werden, damit wir die Emissionen messen und in ein Bild umwandeln können. Wir tendieren jetzt dazu, längere Geräte zu bauen und zu kaufen. Leider sind die sehr, sehr kostspielig, das kann man sich vorstellen. Und sie werden sicher nur in Zentren aufgestellt werden, aber wir in Kiel sind ein solches Zentrum.
Das hat eher so eine Bauart wie einen MRT, das heißt, einen etwas längeren Tunnel. Dort kommen die Patienten hinein und die Emissionen werden alle auf einmalgemessen. Das heißt, die Untersuchungszeit verkürzt sich auf ungefähr drei bis fünf Minuten. Das ist erst mal sehr schnell, aber auch besonders komfortabel für die Patienten, wenn man nur ein paar Minuten im Gerät liegen muss. Das wäre sicher spannend.
Was uns noch ärgert, und das wäre ein Blick in die Zukunft, ist, dass wir leider tatsächlich Patienten haben, die mit einem eindeutig nachweisbaren PSA-Wert ein unauffälliges PSMA-PET-CT haben. Das stellt sich die Frage: Was steckt dahinter? Dafür gibt es andere Tracer, die Sie hier sehen, zum Beispiel Zirkonium, ein Stoff, der auch PET-tauglich ist, also ein PET-Tracer, der aber eine längere Halbwertzeit hat. Dort strahlen die Patienten über einige Tage. Da haben Arbeitsgruppen aus dem Saarland – ein Kollege von mir, Herr Ezzedin, sich besonders hervorgetan – und wir können dann einfach langsam metabolisierende Prostatakarzinomzellen visualisieren, um herauszufinden, wo der Ort ist, warum der PSA-Wert im Blut nun erhöht ist. Das wäre ein spannender Punkt. Auch für die PSMA-Therapie stellt sich die Frage: Kann man anstelle oder in Kombination mit dem Lutetium noch einen anderen Strahler mit einer noch höheren linearen Energietransfer anwenden, um Tumoren kaputt zu strahlen? Das wäre zum Beispiel mit einem Alpha-Strahler, wie hier Actinium, denkbar, dass man noch andere Medikamente, radioaktive Medikamente, verwendet. Am Ende stellt sich die Frage: Kann man die PSMA-Therapie wirklich nur für das fortgeschrittene Stadium anwenden? Das heißt, das kastrationsresistente, metastasierte Prostatakarzinomen. Oder kann man diese Therapie vielleicht schon auf das hormon-sensible Prostatakarzinom anwenden, indem wir sie mit anderen Verfahren kombinieren?
Das wäre so ein Ausblick und etwas, auf das ich hoffe. Dazu haben auch australische Arbeitsgruppen geforscht. Sie sehen, dass die Kombination zur Standard-Care, also Standard-Behandlungsverfahren, plus PSMA-Therapie, eine Verbesserung gezeigt hat, auch im Gesamtüberleben. Das wären Visionen, die ich am Ende loswerden wollte. Visionen, an denen wir arbeiten, um die Situation für den Prostatakarzinom-Patienten weiter zu verbessern.
Das sind meine Kontaktdaten. Wenn Sie noch Fragen haben und heute nicht dazu kommen, das alles zu klären oder wir nachher im Nachgang, sind sie gerne eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen, mir eine E-Mail zu schreiben, ich melde mich gern zurück, um ihnen darüber noch mehr zu berichten. Auf jeden Fall bedanke ich mich für ihre Zeit und die Aufmerksamkeit.
NutzerfragenModerator: Eine Frage: Sie haben es eben schon ein wenig angesprochen und ja eigentlich ein wenig Luft aus dem Thema genommen, aber da kann man doch genauer nachhaken. Und zwar heißt es hier, die Wartezeit auf ein PSMA PET-CT ist oft lang und es ist nur an wenigen Zentren verfügbar. Sie haben es erwähnt und die Bestrebung nach einem Kapazitätsausbau, das ist die Frage. Sie hatten es eben ein bisschen anders erklärt. Wie blicken Sie denn tatsächlich konkret in die Zukunft? Wann ist denn wirklich damit zu rechnen, dass sich diese langen Wartezeiten doch deutlich verkürzen? |