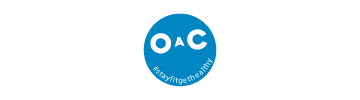Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Prostatavergrößerung: Transurethrale Resektion der Prostata (TURP)
16. September 2025 | von Ingrid Müller - Chefredakteurin, aktualisiert und medizinisch geprüftTURP ist der Standard in der Behandlung einer vergrößerten Prostata. Alle Infos über den Ablauf, die Dauer, Vorteile, Risiken und Nebenwirkungen der TURP. Außerdem: Welche Varianten dieser Prostata-OP es gibt.
Kurzüberblick
|
Was ist TURP?
Die Abkürzung „TURP“ bedeutet “Transurethrale Resektion der Prostata”, Im Rahmen der Prostata-OP tragen Chirurginnen und Chirurgen das überschüssige Prostatagewebe, das zu den Problemen beim Wasserlassen führt, mit Hilfe einer Drahtschlinge und hochfrequentem Strom ab.
Ärztinnen und Ärzte setzen die Methode schon seit vielen Jahrzehnten bei Männern mit einer gutartigen Prostatavergrößerung ein, der benignen Prostatahyperplasie (BPH). Die TURP gilt nach wie vor als Standard, um eine vergrößerte Prostata zu behandeln.
Die Methode zählt zu den minimal-invasiven Eingriffen und geschieht über die Harnröhre („trans" = über, "urethra = Harnröhre“). Solche Eingriffe sind auch unter dem Begriff „Schlüssellochchirurgie" bekannt. Ein großer Bauchschnitt wie bei anderen Operationen ist hier nicht notwendig. Minimal-invasive Eingriffe haben ganz allgemein den Vorteil, dass es weniger Komplikationen gibt, die Heilung schneller verläuft und Sie rascher wieder fit für den Alltag und Beruf sind. Eine TURP müssen Sie stationär in einer Klinik durchführen lassen.
Monopolare und bipolare TURP – was ist was? Es gibt bei der TURP zwei Varianten, die sich im Stromfluss unterscheiden:
|
Ablauf und Dauer der TURP
Besprechen Sie den chirurgischen Eingriff ausführlich mit Ihrem behandelnden Arzt oder der Ärztin. Lassen Sie sich alle Schritte gut erklären und fragen Sie nach, falls Sie etwas nicht verstanden haben. Informieren Sie sich auch über die Vor- und Nachteile, Risiken und Nebenwirkungen sowie über eventuelle Alternativen. Es gibt inzwischen sehr viele Möglichkeiten, um eine Prostatahyperplasie zu behandeln. Sagen Sie Ihrem Arzt auch vorher, ob und welche Medikamente Sie einnehmen. Manche Arzneimittel müssen Sie einige Tage vor der TURP absetzen, zum Beispiel Blutverdünner.
Der Ablauf der TURP lässt sich so beschreiben:
- Sie erhalten entweder eine regionale Narkose (Rückenmarksnarkose, Spinalanästhesie) oder eine Vollnarkose.
- Bei der TURP kommt ein sogenanntes Resektoskop zum Einsatz. Dies ist ein spezielles Endoskop, das sich für minimal-invasive Eingriffe eignet.
- Dieses Instrument – ein kleines, biegsames Röhrchen – ist mit einer winzigen Kamera und Lichtquelle ausgestattet. Ärztinnen und Ärzte schieben es über die Harnröhre bis zur Prostata vor. Auf einem Monitor erhalten sie dann Bilder aus der Prostata. So lässt sich der Eingriff überwachen und steuern.
- Das überschüssige Gewebe wird mit Hilfe einer Elektroschlinge abgetragen. Dies gewährleistet, dass die Prostata die Harnröhre nicht mehr einengt und der Harn wieder besser abfließen kann. Gleichzeitig lassen sich Blutungen aus verletzten Gefäßen durch den Strom und das Erhitzen stillen. Die Schnittflächen werden verödet.
- Über das Resektoskop wird das entfernte Gewebe mit Hilfe einer Flüssigkeit nach außen gespült.
- Die Dauer der TURP beträgt ungefähr 90 Minuten.
- Nach der OP erhalten Sie einen Blasenkatheter, den Sie einige Tage lang tragen müssen. Über den Katheter gelangt der Urin aus der Harnblase nach draußen. Er verbleibt in der Harnröhre, bis die Wunde verheilt ist und Sie wieder selbstständig Wasserlassen können.
- Die meisten Männer können die Klinik nach zwei bis drei Tagen wieder verlassen, manchmal dauert es auch einige Tage länger.
Verhalten nach der TURP
Viele fragen sich, was man nach einer Prostataoperation nicht tun darf. Es gibt einige Dinge, auf die Sie in den ersten Tagen und Wochen nach der OP verzichten sollten. Außerdem sind einige Maßnahmen, die Ihnen in den ersten Tagen und Wochen nach einer TURP im Alltag helfen können.
Einige Tipps:
- Nach der Prostata-OP müssen Sie sich einige Wochen (meist vier bis sechs Wochen) körperlich schonen. Heben Sie keine schweren Lasten, etwa Baumaterialien fürs Haus oder den Garten oder schwere Einkaufstüten.
- Treiben Sie keinen Leistungssport und wenn Sie Sport machen – er sollte nicht zu anstrengend und körperlich belastend sein. Auch auf das Fahrradfahren sollten Sie zunächst verzichten, denn Sie üben dabei Druck auf die Prostata aus. Gegen ausreichende Bewegung im Alltag und maßvollen Sport wie einen flotten Spaziergang, Wandern oder Nordic Walking ist aber nichts einzuwenden.
- Trinken Sie viel, um die Blase zu spülen und die Wundheilung zu fördern. Empfohlen sind ein bis zwei Liter Flüssigkeit am Tag. Gut sind kalorienarme Getränke wie Wasser, ungesüßte Tees oder Fruchtsaftschorlen. Seien Sie sparsam mit Alkohol oder verzichten Sie besser ganz darauf.
- Verzichten Sie in den ersten Wochen auf die Sauna, das Thermalbad und Vollbäder (duschen können Sie).
- Achten Sie auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit vielen Ballaststoffen, um eine Verstopfung zu vermeiden. Wählen Sie zum Beispiel viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Kichererbsen oder Bohnen – sie sind besonders ballaststoffreich.
- Und: Verzichten Sie in den ersten zwei bis drei Wochen nach der TURP auf Geschlechtsverkehr.
Prostata vergrößert? Erfahren Sie alle Symptome und Behandlungen im Überblick - ohne oder mit Prostata-OP. |  |
|---|
TURP: Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Komplikationen
Die TURP reduziert die Symptome beim Wasserlassen sofort, wirksam und nachhaltig – sie besitzt gute Langzeiteffekte. Auch die Lebensqualität verbessert sich. Nur wenige Männer (ca. 2,6 Prozent) müssen sich nach einer TURP einer erneuten Prostata-OP unterziehen. Dies wurde wissenschaftlich in vielen Studien mit hohen Fallzahlen nachgewiesen. Bei einer Prostata mit einem Volumen bis 80 cm3 empfiehlt die Leitlinie zur Prostatavergrößerung die TURP uneingeschränkt.
Einige Zahlen dazu:
- Ungefähr 75 von 100 Männern haben neun Monate nach der TURP nur noch leichte Beschwerden mit ihrer Prostata. Sie müssen nachts nur noch einmal oder überhaupt nicht mehr zur Toilette.
- Den anderen 25 Männern hilft die TURP meist auch, aber etwas weniger als den anderen.
Nachteilig ist, dass die Verweildauer des Blasenkatheters und der Krankenhausaufenthalt länger sind als bei einer bipolaren transurethralen Resektion der Prostata (bTURP). Auch moderne Lasertechniken schneiden in diesen Punkten besser ab, zum Beispiel Holmium-, Thulium- oder Greenlight-Laser.
Die TURP kann einige Nebenwirkungen, Folgen und Komplikationen mit sich bringen. Meist sind sie selten, vorübergehend und bessern sich innerhalb einiger Wochen wieder. Das Risiko für Komplikationen steigt bei einer mTURP, je größer das Prostatavolumen ist.
Möglich sind zum Beispiel:
- Trockener Samenerguss (retrograde Ejakulation): Dies ist die häufigste Nebenwirkung einer TURP und betrifft 50 bis 90 Prozent aller Männer nach einer mTURP. Dabei gelangt die Samenflüssigkeit während der Ejakulation nicht oder kaum über die Harnröhre nach außen, sondern fließt zurück in die Harnblase. Mit dem Urin scheidet der Körper das Sperma dann aus. Die Ursache ist eine Verletzung jener Muskeln während der Prostata-OP, die normalerweise den Ausgang der Blase verschließen. Ein trockener Samenerguss nach der TURP betrifft etwa 65 von 100 Männern. Er schmälert zwar nicht das Gefühl beim Orgasmus, vermindert aber die Fruchtbarkeit.
- Blutungen: Nach dem Eingriff kann manchmal Blut im Urin sichtbar sein.
- Auch ein verstärkter Harndrang nach der TURP ist möglich.
- Daneben haben manche Männer Schmerzen nach dem Wasserlassen.
- Harnwegsinfektionen können vorkommen, wenn Bakterien in den Harntrakt gelangen und sich dort vermehren.
- Inkontinenz – sie ist in der Regel nur vorübergehend
- Verengung der Harnröhre – ebenfalls eine seltene Nebenwirkung
- Erektionsstörungen sind zwar selten, können aber vorkommen. Meist sind sie nicht von Dauer.
Selten, aber nicht ganz ungefährlich, ist das sogenannte TUR-Syndrom mit Übelkeit, Erbrechen oder Verwirrtheit. Es entsteht, wenn die Spülflüssigkeit, mit der Ärztinnen und Ärzte das entfernte Prostatagewebe nach draußen befördern, versehentlich in den Blutkreislauf gelangt. Wenn sie das TUR-Syndrom schnell behandeln, hat es keine ernsthaften Folgen. Diese Komplikation wurde in Studien bei bis zu 1,4 Prozent der Männer beobachtet.
Auch die bTURP verbessert die Symptome und Lebensqualität deutlich. Die Ergebnisse sind mit jenen der mTURP vergleichbar. Vor, während und nach der Operation scheint die Krankheitslast aber geringer zu sein als bei einer mTURP.
Zusammengefasst: Die TURP besitzt eine hohe Wirksamkeit. Sie ruft meist keine langfristigen oder dauerhaften Folgen und Komplikationen hervor.
TURP: Wer trägt die Kosten?
Die TURP ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen bei einer Prostatavergrößerung. Sie übernehmen die Kosten für die Prostata-Op. Die Wirksamkeit der TURP ist wissenschaftlich in vielen Studien gut belegt. Besprechen Sie die Kostenübernahmen immer vor der OP mit Ihrem Arzt oder der Ärztin sowie mit Ihrer Krankenkasse.
TURP – Weiterentwicklungen und Varianten
Inzwischen gibt es einige Varianten der klassischen TURP, die vergleichbare Ergebnisse erzielen und ebenso bei der Behandlung der Prostatavergrößerung zum Einsatz kommen. Dabei entfernen Chirurgen ebenfalls das überschüssige Gewebe, aber mit jeweils anderen Instrumenten und Methoden.
Einige Beispiele für mögliche Alternativen zur TURP:
- Transurethrale Elektrovaporisation der Prostata (TUEVP): Dabei verdampfen Ärztinnen und Ärzte das wuchernde Prostatagewebe mit Hilfe von elektrischer Energie. Genutzt wird dabei die Wärmewirkung des elektrischen Stroms. Zum Einsatz kommt eine spezielle Elektrode (Pilzelektrode), um die sich ein Plasmakegel bildet. Dieser bewirkt, dass das überschüssige Gewebe verdampft (vaporisiert). Die TUEVP soll das Risiko für Blutungen gering halten.
- Transurethrale Vaporesektion (TUVRP): Die Operateurin oder der Operateur entfernt zunächst das Prostatagewebe mit einer Elektroschlinge und verdampft es dann. So soll die Gefahr für Blutungen möglichst gering ausfallen.
- Photoselektive Vaporisation der Prostata (PVP): Dabei kommt ein besonderer Laser zum Einsatz, mit das Prostatagewebe verdampft wird.
FAQs: TURP der ProstataIst eine TURP schmerzhaft? Eine TURP ist in der Regel nicht schmerzhaft, weil der minimal-invasive Eingriff unter einer regionalen Narkose oder Vollnarkose durchgeführt wird. Allerdings können nach der Operation Schmerzen auftreten, wie nach jedem chirurgischen Eingriff. Auch den Blasenkatheter empfinden manche Männer als unangenehm oder schmerzhaft. Wie lange dauert die Heilung nach einer TURP? Die Heilung nach einer TURP ist von Mann zu Mann verschieden. Sie kann aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie müssen einige Tage nach dem Eingriff in der Klinik bleiben und sollten sich nach der Operation weiter schonen. Bis alles gut verheilt ist, kann es einige Wochen dauern. Was ist besser – TURP oder Laser? Ob TURP oder Laser besser ist bei einer vergrößerten Prostata, lässt sich nicht pauschal sagen. Die TURP kann einige Nebenwirkungen mit sich bringen. Moderne Laserverfahren haben bei manchen Punkten Vorteile. Beispiele: Wie lang Sie den Blasenkatheter tragen oder im Krankenhaus bleiben müssen. Kann die Prostata nach einer TURP wieder wachsen? Ja, prinzipiell kann die Prostata nach einer TURP auch wieder wachsen. Allerdings ist ein erneuter Eingriff selten. Bei den meisten bleibt die Prostata über längere Zeit klein und die TURP besitzt gute Langzeiteffekte. Warum ejakuliert man nach einer TURP immer in die Blase? Die retrograde Ejakulation, bei der das Ejakulat in die Blase und nicht in die Harnröhre gelangt, ist eine häufige Nebenwirkung der TURP. Die Samenflüssigkeit wird dann mit dem Urin ausgeschieden. Der Grund ist eine Verletzung der Blasenmuskulatur durch die OP. Der trockene Orgasmus kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, aber das Lustempfinden und der Orgasmus funktionieren in der Regel wie zuvor. Wie lange dauert die Inkontinenz nach einer TURP-OP? Die Inkontinenz nach einer TURP dauert meist nur vorübergehend. Die meisten Männer können ihre Blase binnen Wochen oder Monaten nach der OP wieder kontrollieren. Hilfreich kann ein unterstützendes Beckenbodentraining sein. Selten bleibt die Inkontinenz jedoch dauerhaft bestehen. |
Quellen:
|