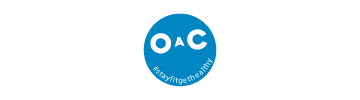Newsletter
Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten Sie monatlich Updates von uns – direkt in Ihr Postfach.
Achtung!
Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf den Eingang der Bestätigungs-Mail.
Welche OP-Verfahren gibt es bei einer gutartigen Prostatavergrößerung?
29. Oktober 2025OP durch den Bauchraum, OP durch die Leiste, Laser-OP, Aquaablation oder neuartige Verfahren wie iTind: Es gibt zahlreiche OP-Verfahren bei einer gutartigen Prostatavergrößerung. Diese haben Vorteile, aber auch Nachteile. Welche das sind und welches Verfahren für welchen Patienten in Frage kommt, erläutert der Urologe Prof. Dr. Jost von Hardenberg.
YouTube inaktiv
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann dieses Modul nicht geladen werden.
Wenn Sie dieses Modul sehen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an.
Prof. Dr. Jost von Hardenberg: Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht kam es bei Ihnen in den letzten Wochen vor, dass Sie auf der Toilette standen und sich wieder gefragt haben, warum der Mann neben Ihnen die Blase viel schneller entleert und wieder aus der Toilette heraus ist. Oder Sie sind morgens verschlafen aufgewacht, weil Sie nachts wieder so oft auf die Toilette mussten. Oder Sie sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, ins Theater und ins Kino gehe ich nicht mehr, denn ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig zur Toilette komme, wenn der Drang einsetzt. Und das, obwohl sie vielleicht schon seit einiger Zeit ein oder sogar ein Kombinationspräparat für die gutartige Prostatavergrößerung nehmen. Das sind Situationen, da darf man über eine Operation nachdenken. Es gibt auch andere Indikationen zur Operation einer gutartigen Prostatavergrößerung. Wenn man nicht mehr Wasserlassen kann und beispielsweise einen Katheter gesetzt bekommen hat, Blasensteine hat oder rezidivierende Harnwegsinfekte. Das sind zwingende Operationsindikationen. Am Ende müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie damit leben können oder sich das Leben nicht etwas zu schwer machen und sich über Operationsmethoden informieren.
Die Operationsmethoden haben alle dasselbe Ziel. Das Ziel ist, Platz zu schaffen, dass der Harnstrahl wieder durch die Harnröhre fließen kann. Und zwar in der Mitte Platz zu schaffen. In der Mitte, wo die Harnröhre entlangläuft. Die OP-Verfahren unterscheiden sich dahingehen, wie ausgeprägt sie in der Mitte Platz schaffen. Optimal ist es, wenn der Platz bis zu der äußeren Zone freigeräumt wird. Denn dann ist die gutartige Prostatavergrößerung vollends behandelt und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den nächsten zehn, 15 Jahren noch einmal eine Operation benötigen, sehr gering. Es gibt zahlreiche Methoden. Diese unterscheiden sich im Zugangsweg. Die meisten Verfahren erfolgen über die Harnröhre. Es gibt aber auch Verfahren, Roboterassistierte oder offene Verfahren, die über die Harnblase oder durch das kleine Becken erfolgen.
Es gibt mittlerweile auch interventionell radiologische Verfahren, also wie bei einem Herzkatheter durch die Leiste, Da komme ich später darauf zurück. Nun hat man die Qual der Wahl. Welches Operationsverfahren wähle ich? Und wir Urologen denken noch an weitere Dinge als nur an das Operationsverfahren.
Ich stelle Ihnen die Operationsverfahren vor. Essenziell, um ein Operationsverfahren auszuwählen, ist: Wie ist die Prostata beschaffen? Größe? Da ist alles dabei. Die Größe ist das Hauptkriterium, um ein Operationsverfahren auszuwählen. Ein weiteres Kriterium ist die Frage, wie die Prostata eigentlich wächst. Also wächst die Prostata nur im Bereich der Harnröhre oder wächst sie auch in die Blase hinein? Das sehen Sie hier, dass die Prostata einen kleinen Hubbel bildet. Hier ist ein Bild aus der Harnblase. Da sieht man so, dass die Prostata in die Blase richtig reinwächst.
Da können Sie sich vorstellen, dass hier gerade das Endoskop zum Spiegeln der Blase durchpasst, da es natürlich ziemlich wenig Platz ist. Es ist außerdem so, dass in dieser Situation Medikamente sehr viel schlechter wirken. Wir müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob es irgendwelche Besonderheiten bei ihnen gibt. Ist zum Beispiel die Harnröhre so eng, dass wir gar nicht durch die Harnröhre operieren können? Gibt es Blasensteine? Es ist sinnvoll, wenn immer möglich, das in einem Eingriff zu operieren. Liegt vielleicht ein Prostatakrebs vor? Auch Patienten mit Prostatakrebs können beides haben. Sie können nach einer Bestrahlung das Problem haben, dass sie nicht richtig Wasserlassen können. Liegt noch ein Kinderwunsch vor? Viele Operationsmethoden führen dazu, dass der Samenerguss in die Blase geht. Das stört die meisten Patienten wenig, wenn ich ihnen das erzähle, sie sagen: Ja, das kenne ich ja sowieso schon von den Medikamenten. Aber es gibt eben auch junge Männer, die das betrifft. Viele Verfahren, die die innere Zone nicht richtig freiräumen, führen dazu, dass eine weitere Operation stattfinden muss. Dann muss das Operationsverfahren entsprechend ausgewählt werden. Ist das überhaupt möglich?
Begleiterkrankungen sind ganz entscheidend. Blutverdünnung: Wofür wird Blut verdünnt? Kann ich die Blutverdünnung absetzen oder gefährde ich damit zum Beispiel eine künstliche Herzklappe? Sind die Patienten immunsupprimiert, zum Beispiel Rheuma? Nehmen Sie viel Cortison? Was haben sie noch für Vorerkrankungen? Wie ist die Narkosefähigkeit? Haben Sie vielleicht neurologische Erkrankungen? Parkinson zum Beispiel. Oder MS? Das sind alles Dinge, die in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Das Thema Lebenserwartung hat, finde ich, einen geringeren Stellenwert bei der gutartigen Prostatavergrößerung, Jeder Mann hat das Recht, auch die letzten zwei Jahre seines Lebens ohne Katheter zu leben. Wenn immer möglich, sollte man versuchen, dass man auch für diese Patienten eine Lösung findet. Wenn wir uns die Operationsmethoden anschauen, dann unterscheiden die sich, in der Heftigkeit oder der Symptomverbesserung, wie ausgeprägt die ist. Sie unterscheiden sich auch in der Nachhaltigkeit, also bei der Frage: Wie viele Jahre haben Sie dann Ruhe?
Dann stellt sich die Frage: Wird eine Histologie gewonnen? Kann man bei der Operationsmethode Gewebe entfernen und das zum Pathologen schicken? Es ist bei Patienten mit großer Prostata gar nicht so selten, dass die Aussagen im MRT nicht ganz schlüssig sind und dass man letztlich in der Gewebeprobe doch Krebs findet. Meistens nicht aggressiv, aber man findet ihn. Eine weitere Frage: Wie sieht es aus mit der Inkontinenz? Wir wollen nicht, dass eine Operation in eine Inkontinenz mündet. Zu diesem Thema zeige ich Ihnen noch Zahlen.
Dann stellt sich die Frage: ambulant oder stationär? Narkose oder keine Narkose? Die Frage ist, operieren wir durch die Harnröhre, die Bauchdecke oder die Leistengefäße. Das sind alles sekundäre Themen. Deswegen habe ich die Symptomverbesserung und die Nachhaltigkeit fett markiert. Das sind die Aspekte, die für Sie am wichtigsten sind. Zum Schluss geht es auch noch um die Verfügbarkeit in Ihrer Region. Nicht überall gibt es alle Operationsmethoden. Das ist auch nicht immer notwendig, weil viele Operationsmethoden in den Zentren vor Ort häufig durchgeführt werden. Das ist für Sie wichtiger, als hunderte Kilometer weit zu fahren. Am Ende hat man eine Komplikation, wenn man wieder zu Hause ist. Es ist wichtig, einen Operateur mit Erfahrung zu haben, ein Zentrum, in dem eine OP häufig gemacht wird. Kommen wir zum nächsten Schritt Was verbirgt sich jetzt hinter den Türen? Was sind die einzelnen Operationsmethoden?
Zunächst die Zugangswege durch die Bauchdecke oder durch das kleine Becken. Das sind die invasivsten Operationen. Wann immer wir die Möglichkeit haben, nicht durch die Bauchdecke zu gehen, ist das ein Gewinn. Trotzdem gibt es diese Methoden, die bei sehr großen Prostatas infrage kommen, oder wenn die Harnröhre verschlossen ist. Das geht hier durch das Becken und wird in vielen Teilen der Welt tagtäglich so operiert. Die Prostata kann mit dem Finger herausgeschält werden. Warum kann sie mit dem Finger herausgeschält werden? Weil die innere und die äußere Zone wie eine Zwiebelschale aufeinander liegen. Man kann die Prostata also mit dem Finger herausschälen oder man kann die Operation mit dem Laser durchführen. Oder man kann die OP mit dem Roboter durchführen. Das sind hocheffektive Verfahren, super Symptomverbesserung, super nachhaltig. Das Gewebe wird auch eingeschickt, aber wir haben eine enorm hohe Komplikationsrate, was Blutungen angeht, was den Zugangsweg angeht. Es ist nicht jeder nicht voroperiert im Bauch. Zum Ejakulationserhalt: Wenn ein Kinderwunsch besteht, bietet sich das Verfahren auch nicht an. Wobei, auch das kann man machen. Man kann die Spermien später aus dem Urin heraus zentrifugieren. Da muss man in eine Kinderwunschzentrum gehen. Da gäbe es noch Möglichkeiten. Stationär ist die Liegedauer relativ lang und natürlich findet dieses Verfahren in Narkose statt.
Kommen wir zum nächsten Verfahren: durch die Harnröhre. Über viele Jahrzehnte durchgeführt, das Verfahren, das bei etwa 80 Prozent der Männer angewandt wird, ist die TURP, die Ausstellung oder Ausschabung der Prostata. Sie haben diese kleine Schlinge hier und diese kleine Schlinge wird heiß. Das hat zwei Vorteile Wir können damit schneiden und wir können damit Blutstillung machen und eben die gutartige Prostatavergrößerung herausschneiden. Die Symptomverbesserung ist sehr gut. Das Verfahren ist relativ nachhaltig. Das hängt ein bisschen davon ab, wo Sie operieren lassen und ob das der Operateur regelmäßig macht. Auf Krebs wird untersucht. Die Komplikationen: Je größer die Prostata wird, desto größer ist die Wundfläche und desto wahrscheinlicher ist auch, dass es zum Beispiel nachblutet oder dass die Patienten nach der Operation einen Infekt bekommen – einen Harnwegsinfekt, den man aber gut mit Antibiotika behandeln kann.
Die Ejakulation erhalten: Es gibt Techniken, die das ermöglichen. Die OP wird stationär durchgeführt, in Narkose, und eignet sich für fast alle Prostatas, bis 80 Milliliter. Sie ist fast überall verfügbar. Das ist der Vorteil. Vom Adenom werden in der Regel nur 30 bis 40 Prozent entfernt. Deswegen ist es nicht so nachhaltig. Meistens reicht es aber aus. Das Verfahren hat etwas mehr Komplikationen als die Laserenukleation, zu der ich als nächstes komme. Die Laserverfahren sind Holmium-Laser-Enukleation oder Thulium-Laser-Enukleation. Diese Verfahren machen sich das zunutze, was ich eben erklärt habe, den Aufbau wie bei einer Zwiebelschale.
Der Laser, der löst nur diese Fasern hier. Hier sehen Sie das Bild aus dem Operationssaal. Hier ist die Laserfaser. Hier unten ist die äußere Zone. Und hier oben ist die innere Zone, das Adenom. Das, was wir herausholen wollen. Wir spannen das auf. Und der Laser? Der verödet diese Fasern. Damit kann das Adenom nach und nach herausgelöst werden. Dann werden diese Lappen in die Blase geworfen. Sie sind viel zu groß, um sie durch die Harnröhre herauszubekommen. Dann gibt es einen kleinen Häcksler mit einem Messer, der sich dreht und gleichzeitig das Gewebe ansaugt. Das Gewebe wird durch die Harnröhre herausgezogen und kann auf Krebs hin untersucht werden. Die Symptomverbesserung ist exzellent. Das ist ein sehr nachhaltiges Verfahren, weil man eben auf der Kapsel das ganze Adenom entfernt. Man kann das Gewebe auf Krebs untersuchen, wie ich eben schon gesagt hatte. Die Komplikationsrate ist gering. Sie steigt etwas an mit der Größe der Prostata, weil die Wundfläche dann sehr groß ist. Die Potenzrate ist etwas besser als nach der TUR-P. Ejakulationserhaltend ist das Verfahren meistens nicht. Der stationäre Aufenthalt liegt in der Regel bei drei Tagen, Plus-Minus, das hängt vom Alter ab. Es hängt auch davon ab, ob die Patienten blutverdünnt sind oder nicht. Und man muss es in Vollnarkose durchführen. Das Verfahren ist der nachhaltige Goldstandard, kann bis zu einer Prostata-Größe von 200 Millilitern durchgeführt werden und ist relativ komplikationsarm.
Ein neueres Verfahren, das in den letzten Jahren beschrieben worden ist, ist Aquaablation. Die Idee ist, dass durch den Enddarm ein Ultraschall der Prostata gemacht wird und darüber über einen Katheter durch die Harnröhre eingestellt wird, welches Gewebe mit einem Hochdruckwasserstrahl zersetzt wird. Die Symptomverbesserung ist auch da gut, die Nachhaltigkeit ist teilweise nicht ganz so gut, weil am Blasenhals nicht optimal gearbeitet werden kann. Teilweise kann das Gewebe auch untersucht werden auf Krebs. Die Komplikationen sind sogar etwas höher als bei der TUR-P, weil die Blutstillung nicht gewährleistet wird und das Gewebe sehr matschig ist, muss man in Anführungszeichen sagen. Ejakulationserhaltend ist es, der stationäre Aufenthalt ist kurz, es muss in Vollnarkose durchgeführt werden und eignet sich für Drüsen bis 80 Milliliter. Es gibt bisher wenig Langzeitdaten und die Re-OP-Rate ist etwas höher als bei der TURP.
Als nächstes kommen wir zu UroLift, das sind sogenannte Anker, permanente Prostata Anker, die man über die Harnröhre einsetzt. Diese Anker sollen eben den Weg freimachen. Da wird kein Gewebe entfernt, es ist ein leichtes Verfahren. Man kann das Gewebe deswegen auch nicht auf Krebs hin untersuchen. Das Verfahren ist nicht so nachhaltig. Komplikationen gibt es auch. Beckenschmerzen werden da häufig beschrieben. Der große Vorteil ist der Ejakulationserhalt, der eigentlich immer gelingt. Das geht bei Patienten, die keinen Mittellappen haben. Bei einer Situation, die Sie anfangs gesehen hatten, das Bild aus dem Endoskop, wo die Prostata vorwächst, eignet sich das Verfahren nicht. Der UroLift ist etwas weniger effektiv. Die Erholung geht schnell, aber die Re-OP-Rate ist relativ hoch. Denn in der Prostata wächst alles weiter. Auch die Medikamente muss man in der Regel weiter nehmen.
Dann gibt es noch Verfahren, die eine geringere Evidenz haben in der Wissenschaft. Deswegen zeige ich sie separat. Das eine ist (iTIND), ein Körbchen, das wird durch die Harnröhre eingebracht, verbleibt für einige Tage in der Harnröhre und drückt die Prostata zur Seite. Das soll zu Zelluntergang führen, Das tut es auch und verbessert so das Wasserlassen. Das ist ein minimal invasives Verfahren. Der Effekt ist nicht so groß. Das Körbchen muss auch wieder rausgeholt werden. Das ist sicher nichts, um das Thema dauerhaft zu beheben, aber als Lösung eine Option.
Das zweite ist Rezum, das sind sogenannte Wasserdampfstöße, die in die Prostata eingebracht werden. Die Symptomverbesserung ist gut, aber das Verfahren ist nicht ganz so nachhaltig. Nicht wie beim Laser, bei dem ich das Ganze genau herausnehmen kann. Bei dem Verfahren lenke ich den Wasserdampfstrahl dorthin, wo ich meine, dass der Ort der größten Not ist, also die größte Verengung. Ein Vorteil ist, dass das Verfahren ambulant durchgeführt werden kann. Ein Nachteil ist, dass es oft zu Harnverhalten führt. Der Effekt setzt erst viel später ein. Außerdem hat das Verfahren bisher eine niedrige Evidenz.
Das letzte Verfahren, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist die OP durch die Leiste: Bei diesem Verfahren braucht der Patient keine Narkose. Man kann es ambulant durchführen und es hat eine sehr geringe Komplikationsrate. Nachteile sind die Symptomverbesserung, die Nachhaltigkeit und die Krebsuntersuchung. Ein weiterer Nachteil ist die sehr hohe Re-OP-Rate. Es sind gerade die Fünf-Jahres-Daten herausgekommen und bis zu 50 Prozent der Patienten brauchen nach fünf Jahren eine erneute Operation. Jetzt können sie schwarz malen und sagen: Das ist eine schlechte Methode. Aber es gibt Patienten, die sehr alt sind, die nicht narkosefähig sind, die von ihrem Katheter weg möchten. Da ist das oft das einzige Verfahren, das möglich ist.
Eine permanente Inkontinenz nach der Operation wollen wir nicht haben. Wir wissen, dass Patienten, die eine sehr große Prostata haben, die sehr spät zur Operation kommen, die schon eine Dranginkontinenz haben, die schon jeden Tag Vorlagen benötigen, weil sie auf dem Weg zur Toilette Urin verlieren und das unter Medikamenten, das sind Patienten, mit denen muss man ehrlich sprechen, dass sie wahrscheinlich weiter Vorlagen benötigen werden. Und wenn ein gutes Ergebnis nach der OP eintritt, dann dauert das eine ganze Weile, bis der Harnblasenmuskel, der sich auch verändert, wenn die Prostata vergrößert ist, wieder kleiner geworden ist.
Ich komme zur Zusammenfassung: Diese Zusammenfassung vom NHS aus England finde ich gut. Sie zeigt die Verfahren auf nach Verbesserung des Harnstrahls. Je besser, Platz für die Harnröhre geschaffen wird, desto besser ist natürlich auch der Harnstrahl. iTind, das radiologische Verfahren PAE; UroLift und Rezum bewirken eine weniger ausgeprägte Harnstrahlverbesserung als Aquaablation, TURP und HoLEP. Greenlight ist ein weiterer Laser. Das sind die Verfahren, die viel effektiver sind, Aber man erkauft sich das mit einer etwas längeren Erholungszeit. Die Erholungszeit liegt bei einer bis 3 Wochen beim Laser, bei der Aquablation dauert es schon mal drei Monate, bis sich alles wieder beruhigt hat. Nun kann man sagen, die Prostata ist auch nicht in drei Monaten gewachsen. Wir sprechen hier über Jahre. Man hat ein paar Wochen länger Erholungszeit, aber dafür eben auch sehr nachhaltige Verfahren.
Diese ganzen Verfahren, ein Labyrinth: Gemeinsam entscheiden müssen Sie mit Ihrem Urologen. Wie Sie diese Entscheidung besser treffen können, dazu läuft gerade eine Studie über Shared Decision Making, ein dänisch deutsches EU-Forschungsprojekt, welches Shared Decision Making mehr in die Welt trägt. Drei Fragen sollten Sie sich notieren: 1: Welche Möglichkeiten habe ich? 2. Was sind die Vorteile und die Nachteile? 3. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Vorteile und Nachteile bei mir auftreten? Damit löchern Sie den Urologen, der vor Ihnen sitzt, und fragen ihn. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Patienten, der gesagt hat, er stände für ein Interview zur Verfügung, zeigen, der berichtet, wie es ihm so anderthalb Wochen nach einer Operation geht. Er ist relativ jung, hatte einen Harnverhalt vorher und hat sich sehr gequält. Ich zeige Ihnen, wie er sich anderthalb Wochen nach der OP fühlte.
Patienteninterview: Marc Fröhlich: Jetzt, nach knapp eineinhalb Wochen und drei Tagen Krankenhausaufenthalt, war dieses positive Erlebnis, zum Pinkeln zu gehen, sofort lospinkeln zu können und innerhalb von 12 bis 15 Sekunden die Blase zu entleeren, bin ich so positiv und habe einfach auch deutliche Lebensfreude und dort wieder eine Lebensqualität erlangt.
Prof. Dr. Jost von Hardenberg: Gut. Damit bin ich am Ende und bedanke mich.
Moderator: Ganz herzlichen Dank, Herr Professor von Hardenberg. Das Schöne heute ist wirklich, dass am Ende der Vorträge, die sich mit einem Problem beschäftigen, so muss man es ja ganz deutlich sagen, immer eine positive Nachricht kommt, jetzt auch gerade wieder. So soll man es gerade in den Zeiten, die wir sowieso erleben, aber auch wenn man so eine Krankheit am Wickel hat, so soll man es machen. Sehr schön, Herr Professor von Hardenberg. Aber auch an Sie noch eine Frage eines Patienten. Und zwar hat dieser Patient seit 15 Jahren eine gutartige Prostatavergrößerung, die mit Dutasterid-Tamsulosin behandelt wird. Der PSA Wert wird regelmäßig kontrolliert. Die Frage Ist es immer noch möglich, dass sich daraus Prostatakrebs entwickeln kann?
Prof. Dr. Jost von Hardenberg: Das ist ein Kombinationspräparat, das zu einer nachhaltigen Verkleinerung der Prostata führt und dazu führt, dass der PSA-Wert sich etwa halbiert. Diese Patienten sind gefährdet, dass man in Prostatakarzinom übersieht, weil der PSA-Wert immer niedrig ist. Selbstverständlich können Patienten zu jedem Zeitpunkt ein Prostatakarzinom entwickeln. Ich habe gerade letztens einen Patienten gesehen, der einen PSA-Wert von vier hatte. Er ist dann in der Versenkung verschwunden, kam nicht mehr zur Nachkontrolle und drei Jahre später war der PSA-Wert bei 100. Das ist zu jedem Zeitpunkt möglich und die Patienten müssen weiterhin unter urologischer Kontrolle oder Vorsorge sein.
Moderator: Vorsorge Vorsorge. Vorsorge. Ich danke Ihnen, Herr Professor von Hardenberg.